Raúl Aguayo-Krauthausen's Blog, page 27
April 22, 2018
Freiwillige Barrierefreiheit in der Wirtschaft? Eine Illusion.

“Menschen mit Behinderung müssen bitte draußen bleiben”. Barrierefreiheit auf freiwilliger Basis bedeutet leider nach wie vor: Viele behinderte Menschen haben keinen Zugang zu Banken, Ärzten, Restaurants und Erholungs- und Freizeit-Locations. Und auch Transportunternehmen wie FlixTrain scheinen Barrierefreiheit als Option zu verstehen – aber nicht als Umsetzung eines Menschenrechts.
Praktisch alle sind sich einig, dass Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden vorhanden sein sollte. Meldestellen, Gerichte und ähnliche Orte müssen grundsätzlich für alle Bürger*innen zugänglich sein. Der Gesetzgeber hat im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) klar festgelegt, wie Barrierefreiheit im öffentlich-rechtlichen Raum umgesetzt werden muss.
Wenn aber darüber diskutiert wird, ob man die Wirtschaft ebenfalls zur Barrierefreiheit verpflichten sollte, haben Regierung und die nicht behinderte Mehrheitsgesellschaft große Bedenken. Die dadurch entstehende finanzielle Belastung sei einfach nicht zumutbar. Deshalb überlässt man den Unternehmen selbst, ob sie Barrierefreiheit umsetzen wollen oder nicht. Selbst in der Novellierung des BGG 2016 konnte sich die Bundesregierung nicht zur Verpflichtung der Privatwirtschaft durchringen. Obwohl die von Deutschland mitunterzeichnete UN-Behindertenrechtskonvention ganz eindeutig “umfassende Barrierefreiheit” fordert.
Kein Zugang für Menschen mit Behinderung
Die Folgen im alltäglichen Leben vieler behinderter Menschen sind einschneidend. Ein entspannter Abend im Restaurant und danach ein Kinobesuch – in vielen deutschen Städten nicht möglich.
Noch gravierender: Viele Arztpraxen und Banken sind nicht barrierefrei.
Wenn ich mit dem Sachbearbeiter meiner Bank reden muss, bin ich gezwungen bei meiner Bankfiliale zu klingeln und das Gespräch vor der Tür auf der Straße zu führen. Nicht barrierefreie Geldautomaten lassen mir regelmäßig keine andere Möglichkeit, als wildfremden Menschen meine Geheimnummer zu verraten, damit sie für mich Geld abheben.
Bei der Forderung nach Verpflichtung der Wirtschaft zur Barrierefreiheit geht es nicht – wie so oft von Barrierefreiheitgegnern*innen angebracht – um den kleinen Zeitungsladen, der durch die entstehenden Kosten eines Aufzugeinbaus unweigerlich in den Ruin getrieben würde.
Es geht um Banken, Ärzte, große Läden, Restaurants, Transportunternehmemn usw., denen die Verpflichtung zur Barrierefreiheit durchaus zumutbar wäre.
Die Regierung blockiert
Im vergangenen Jahr hatten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine kleine Anfrage eingereicht zum Thema “Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft”. Dabei bezogen sie sich auf einen bereits 2015 von der Europäische Kommission vorgelegten „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen“, auf den sich die Mitgliedstaaten u.a. wegen der Vorbehalte der Bundesregierung seit mehr als 2 Jahren nicht einigen konnten. Die Antwort der Bundesregierung war desillusionierend und versprach weitere Verzögerungen: Natürlich unterstütze man die Richtlinie “ausdrücklich” – aber es gäbe nach wie vor zu viele Punkte, die konkretisiert werden müssten. Dabei galt die größte Sorge der wirtschaftlichen Belastung der Wirtschaft durch die Verpflichtung zur Barrierefreiheit. CDU, CSU und die SPD ignorieren mit dieser Sichtweise komplett die Erfahrungen von Staaten, in denen Barrierefreiheit für die Privatwirtschaft bereits Pflicht ist. Tatsächlich konnten die Unternehmen in Großbritannien, den USA und weiteren Ländern aufgrund von Barrierefreiheit ihren Kundenstamm erweitern und ihre Erträge steigern.
Einen Versuch etwas Schwung in das Thema zu bringen, versucht jetzt DIE LINKE und reichte im letzten Monat einen Antrag ein: „Menschenrecht auf Barrierefreiheit umsetzen – Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichten“.
Vollkommen zutreffend wies die ehemalige behindertenpolitische Sprecherin DER LINKEN Katrin Werner darauf hin, dass “ das Leben der Menschen (…) sich nicht nur in Bundesbehörden (ab)spielt.”
Kein Platz für behinderte Menschen im FlixTrain
Aktuell zeigt ein Beispiel aus der Wirtschaft, wie die fehlende Verpflichtung zur Barrierefreiheit behinderte Menschen ausschließt.
Unter dem Hashtag #bahnbrechend macht FlixTrain Werbung für sein extrem günstiges neues Angebot. Der Unternehmer FlixBus schreibt: “Grüne Züge und Mobilität für alle”.
Das klingt gut. Ebenso wie 9.999 Tickets für 9.99 Euro. Und das Versprechen, dass die zwei günstigen Zugstrecken mit den Buslinien verzahnt werden und damit eine gute, günstige Mobilität für alle Menschen in Deutschland möglich ist.
Da viele Menschen mit Behinderung nach wie vor Probleme haben, einen gut bezahlten Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt zu finden und oftmals in Werkstätten mit extrem geringem Lohn arbeiten müssen, sind ihre finanziellen Möglichkeiten oft sehr begrenzt. Sie wären also genau die richtige Zielgruppe für ein günstiges Transportangebot “für alle”.
Wenn man sich das Angebot von FlixTrain allerdings genauer anschaut, stellt man fest, dass hier ein Versprechen eindeutig gebrochen wird: Die Mobilität für alle.
In den FAQ der FlixTrain-Seite steht: “In den Zügen können nur Rollstühle befördert werden, die maximal folgende Maße von Breite 60 cm x Länge 120 cm und das Gewicht, zusammen mit Dir, von 350 kg nicht überschreiten.” Standard-Elektrorollstühle sind allerdings üblicherweise breiter und können somit gar nicht befördert werden.
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat hier klare Anweisungen:
Für Menschen in Aktiv-Rollstühlen, mit Gehhilfen o.ä. gibt es Transportmöglichkeiten, wenn man sich auf einen Bahnsitzplatz umsetzen kann. Das Hilfsmittel muss allerdings spätestens 36 Stunden vor Reisebeginn angemeldet worden sein. Nicht wirklich flexibel – aber immerhin machbar.
Ich fragte bei FlixTrain bezüglich der mangelhaften Barrierefreiheit nach und erhielt Antwort von Patrick Kurth, dem Leiter “Politik bei FlixTrain”: Da man nur zur Verfügung stehendes Wagenmaterial nutze und “ein großer staatsnaher Bahnanbieter” dafür sorge, dass das Marktangebot an Waggons sehr gering sei, ginge das auf Kosten der Barrierefreiheit.
Ein altbekanntes Argument vieler Unternehmen: An Barrierefreiheit wird oft als erstes gespart.
Man entwickle zusammen mit dem Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderte (BSK) und dem Deutschen Behindertenrat (DBR) ein Papier, in dem man gemeinsame Positionen und Forderungen manifestieren wolle – ein solches Dokument hätte es seines Wissens weder bei der Bahn, Luftfahrt oder Fahrzeughersteller bisher gegeben. Er bot mir ein Treffen an – das allerdings bisher nicht stattfand.
Was bisher feststeht, sind die Fakten: Ein nicht vollständig barrierefreies neues Transportangebot, das nicht wenige Menschen mit Behinderung ausschließt.
Gerade Unternehmen, die neue Mobilitätsangebote entwickeln, dürfen nicht ausgrenzend und diskriminierend planen. Stattdessen muss bereits in der Finanzierungsphase zwingend Barrierefreiheit mitgeplant werden. FlixTrain ist ein Beispiel dafür, dass die Privatwirtschaft dies nicht auf freiwilliger Basis macht – und deshalb von der Politik dazu gezwungen werden muss. Warum also lässt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein neues, diskriminierendes Mobilitätsangebot zu? Die Antwort auf diese Frage bleibe ich euch schuldig – würde sie aber selbst gerne von unserem neuen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hören. Ebenfalls, wie er nun mit dem Problem umgehen möchte.
Ein Grund für uns alle, aktiv zu werden und den zuständigen Politiker, von dem ich bisher keine Stellungnahme zu Thema finden konnte, nach seinen geplanten Maßnahmen zu fragen:
Schreibt an den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer: andreas.scheuer@bundestag.de
Auch FlixTrain sollte lernen, dass Barrierefreiheit keine Lappalie ist:
Hier kann man FlixTrain schreiben.
(sb)
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit Suse Bauer zuerst in leicht abgewandelter Form in „neues deutschland“ erschienen.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 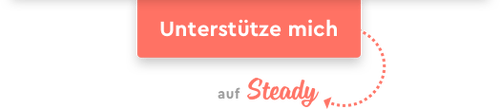
April 21, 2018
KRAUTHAUSEN – face to face: Shahak Shapira, Satiriker
In der Sendung „KRAUTHAUSEN – face to face“ lade ich als Moderator Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende und Medienleute mit und ohne Behinderung zum Talk ein. In “face to face”-Gesprächen tausche ich mich mit einem jeweiligen Gast über künstlerisches Schaffen, persönliche Interessen und Lebenseinstellungen aus. Und natürlich geht es auch ab und zu um das Thema Inklusion.
Als vierzehnten Gast hatte ich den Satiriker Shahak Shapira zu besuch
Zum Video mit Gebärdensprache hier entlang auch Verfügbar mit Audiodeskription (AD).
Zu Gast bei KRAUTHAUSEN – face to face: Shahak Shapira, Künstler, Schriftsteller, Musiker und Satiriker.
Mit Raul Krauthausen unterhält er sich über seine Karriere als Satiriker und über die Grenzen von Humor.
Mehr Infos:
shahak.de
Erstausstrahlung: 21.04.2018, 9.30 Uhr, Sport 1
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 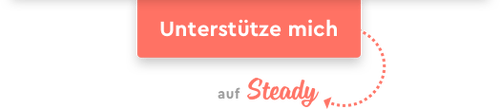
April 4, 2018
Behinderteneinrichtungen und Inklusion – ein unvereinbarer Gegensatz?
 Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zeichnen sich nach wie vor durch paternalistische Strukturen aus. Obwohl sie sich nach außen hin oft als Vorreiter der Inklusion feiern, sind sie selbst ein Hinderungsgrund auf dem Weg zu realer gesellschaftlicher Teilhabe.
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zeichnen sich nach wie vor durch paternalistische Strukturen aus. Obwohl sie sich nach außen hin oft als Vorreiter der Inklusion feiern, sind sie selbst ein Hinderungsgrund auf dem Weg zu realer gesellschaftlicher Teilhabe.
Als ich vor kurzem in den Sozialen Medien auf ein Video der Diakonie Bayern stieß, wurde mir das Dilemma rund um das Thema Inklusion und Behinderteneinrichtungen mal wieder drastisch bewusst:
In “Sendung mit der Maus”-Erklärvideo-Manier wird mit kleinen Playmobil-Männchen beschrieben, wie Menschen mit Behinderung in Deutschland leben – und was die Diakonie so Gutes dafür tut. Erzählt wird die Geschichte vom Rollstuhlfahrer Werner. Der Werner wohnt in einer Wohngruppe und arbeitet in einer Behindertenwerkstatt.Dabei lässt die Erzählweise des Sprechers keinen Zweifel aufkommen, dass dies die einzige für Werner mögliche Lebensweise ist.
Selbst entscheiden darf der Werner nix – kann er als behinderter Mensch ja auch gar nicht. Den Eltern vom Werner blieb offensichtlich nur die Möglichkeit, ihren Sohn in eine Einrichtung zu stecken. Das war in seinem Fall die Diakonie, hätte aber auch ein anderer Träger sein können.
Maximale Selbstbestimmung: Werner darf sich aussuchen, von wem er sich am liebsten helfen lassen will. Behauptet jedenfalls das Diakonie-Filmchen – bei meinem Heimexperiment habe ich erlebt, dass man sich in der Praxis nicht viel aussuchen kann, wenn man in einer Behinderteneinrichtuing lebt. Auch nicht, welcher Mensch einen wäscht, auf die Toilette setzt oder anzieht. Das bestimmte in meinem Fall alleine der Dienstplan.
Ganz offensichtlich meint die Diakonie es gut und glaubt, das Richtige zu tun. Dass hier auf erschreckende Weise die Misere vieler behinderter Menschen gezeigt wird, ist den Machern*innen scheinbar nicht bewusst: Der – natürlich mit dem Vornamen bezeichnete – Vorzeige-Behinderte hat keine Kontrolle über sein Leben, wird in jeder Entscheidung eingeschränkt und von Inklusion kann keine Rede sein.
Dass das Video bereits 4 Jahre alt ist und sich in der vergangenen Zeit nichts in dem Bereich geändert hat, ist zusätzlich bitter.
Auf kritische Twitter-Kommentare reagierte die Diakonie Bayern mit Unverständnis. Was Inklusion ist, scheint also Interpretationssache zu sein.
Ein Blick auf die Protagonisten
Zu den großen Trägern gehören die Lebenshilfe sowie die Behindertenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes, die Diakonie und die Caritas. Die beiden letztgenannten sind mit Abstand die ältesten – sie blicken mittlerweile beide auf eine rund 170-jährige Geschichte zurück. Gegründet wurden sie im 19. Jahrhundert und hatten als Maßstab die christlichen Nächstenliebe, die allen Menschen helfen möchte. Das war zu jener Zeit gewiss ein guter Ansatz und hat das Leben vieler Menschen mit Behinderung bezogen auf die damaligen Zustände verbessert. Es wurden Förderschulen geschaffen und Arbeits- und Wohnmöglichkeiten in Behinderteneinrichtungen.
Heute allerdings geht es nicht mehr darum, behinderten Menschen Mitleid und Barmherzigkeit angedeihen zu lassen – und sie möglichst nach christlichen Maßstäben angemessen zu verwahren und zu beschäftigen.
Stattdessen geht es um gleichberechtigte Teilhabe und die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung u.a. nach den Kriterien der UN-Behindertenrechtskonvention. Nicht nach Ermessen barmherziger nichtbehinderter Menschen zugeteiltes Mitleid – sondern Durchsetzung unabdingbarer Gleichberechtigung. Nicht ein Leben in Sondereinrichtungen – sondern ein Leben in Selbstbestimmung.
Wenn allerdings Inklusion tatsächlich stattfinden würde, behinderte Menschen am ersten Arbeitsmarkt arbeiten, in eigenen Wohnungen mit Assistenz u.ä. leben würden – wäre das logischerweise das Ende aller Wohlfahrtseinrichtungen, die von der Ausbildung, Beschäftigung und der Verwahrung behinderter Menschen leben.
Inklusion würde also die mittlerweile riesigen Wirtschaftsunternehmen der Wohlfart abschaffen.
Bestehende Systeme werden gefestigt
Statt Inklusion voranzutreiben, drehen die großen Einrichtungen der Wohlfahrt nur an kleinen Stellschrauben. Denn jedes Mal, wenn sie etwa einen höheren Verdienst für Mitarbeiter*innen in Behindertenwerkstätten fordern, eine neue Wohnform für behinderte Menschen entwickeln oder nach mehr Geld für die Pflege rufen, verfestigen sie dadurch ihr bestehendes System. Und in ihrem System können Werner und andere behinderte Menschen aus gutem Grund nicht mitbestimmen.
Sehr treffend bringt dies die GRÜNEN-Politikerin Corinna Rüffer auf den Punkt. Sie schrieb Mitte März einen Kommentar auf Facebook:
Wenn ein inklusiver Arbeitsmarkt das Ziel ist, würde ich jeden politischen Vorschlag danach überprüfen, ob er ein bestehendes Sondersystem stabilisiert …
Dabei bezog sie sich auf einen Kobinet-Artikel, in dem die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Aufsichtsrats-Mitglied bei Aktion Mensch Ulla Schmidt ein höheres Entgelt für Mitarbeiter*innen in Behindertenwerkstätten fordert. Dabei kommen einem gleich mehrere kritischen Gedanken in den Sinn:
Zum einen war Ulla Schmidt von 2001 bis 2009 Bundesministerin für Gesundheit – in dieser Zeit hat sich in Sachen Behindertenrecht nicht viel getan.
Zum anderen ist Schmidt mittlerweile Vorsitzende der Lebenshilfe – ist also fraglos Unterstützerin des Wohlfahrtssystems. Und könne – als Vorsitzende – ja einfach den gesetzlichen Mindestlohn in den Lebenshilfe-Werkstätten geltend machen. Tut sie aber offensichtlich nicht.
Und selbst wenn sie das tun würde, stünden wir wieder vor dem oben genannten Problem: Inklusion wird verhindert, um die Existenz der Sondereinrichtungen nicht zu gefährden.
Man muss es klar sagen: Über 100 Euro mehr oder weniger für Behindertenwerkstattangestellte zu diskutieren, ist pure Augenwischerei. Hier wird ein kleines Pflaster auf eine riesige, schwelende Wunde geklebt – die sich dadurch nie bessern wird.
Freiwillig werden lukrative Pflege-Imperien, die u.a. durch eine Masse an staatlichen Subventionen unterstützt werden, sich nicht abschaffen. Hier ist der Gesetzgeber gefragt, der streng nach den Forderungen der UN-Behindertenkonvention Inklusion umsetzen muss.
Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr bei: Ability Watch.
(sb)
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 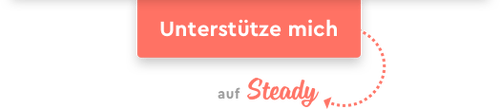
March 27, 2018
Behinderte Potenziale: Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt

Menschen mit Behinderung haben es auf dem Arbeitsmarkt schwer. Zu oft stehen ihre Schwächen und nicht ihre Potenziale im Vordergrund. Unternehmen berauben sich und potentiellen behinderten ArbeitnehmerInnen dadurch vielfältiger Chancen. Ein paar Gedanken dazu.
Allgemeine Befürchtungen
Ein/e neue/r MitarbeiterIn mit Behinderung? Das klingt für viele Unternehmen problematisch.
Da muss dann eine Rampe her. Oder wie ist das mit Blindenschrift? Eine Toilette extra für Mitarbeitende im Rollstuhl? Vom unkalkulierbaren Krankheitsrisiko ganz zu schweigen.
So oder so ähnlich dürften die Argumente in vielen Firmen klingen, wenn es um die Frage geht, ob ein Mensch mit Behinderung als ArbeitnehmerIn in Frage käme. Tatsächlich lassen sich Kosten für Rampen, Blindenschrift oder den Toilettenumbau nicht wegdiskutieren. Aber es gibt hier viele Lösungen und finanzielle Hilfsmöglichkeiten, die zunächst groß erscheinende Probleme rasch lösen können.
Es geht natürlich nicht darum, behinderte Menschen auf Stellen zu besetzen, die ihnen aufgrund ihrer Behinderung unmöglich sind. Aus mir wird kein Dachdecker oder Berufsboxer. Aber in praktisch allen Berufen, die im Büro stattfinden – in Agenturen, öffentlichem Dienst, Versicherungen usw. – bin ich, so wie viele andere Menschen im Rollstuhl, genauso einsetzbar wie jeder nicht behinderte Mensch mit gleicher Qualifikation.
Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass behinderte Menschen weniger Talente haben als nichtbehinderte, nur weil ihre Schwächen offensichtlicher erscheinen.
Das tatsächliche Problem sind die Barrieren in den Köpfen der Unternehmen, Arbeitgeber und Arbeitsämter.
Vielfalt tut Unternehmen gut
Volker Rothaug, Personalleiter bei Siemens in Erlangen, berichtet, dass seine KollegInnen und er sich bei der Suche nach passenden MitarbeiterInnen nicht vom Merkmal “Behinderung” abschrecken lassen. Dadurch kann das Unternehmen auf einen größeren Pool an KandidatInnen zurückgreifen und offene Stellen oft schneller und optimal besetzen. Rothaugs Erfahrung ist es, dass die Arbeitsplatzanpassungen für behinderte MitarbeiterInnen tatsächlich viel geringer sind, als man früher fürchtete.
Ein weiterer positiver Faktor ist die größere Vielfalt, die auch durch behinderte MitarbeiterInnen entsteht: Ihre persönlichen Erfahrungen ermöglichen ihnen meist einen anderen Blickwinkel auf Problemstellungen. So können sie beispielsweise Produkte auf Barrierefreiheit hin bewerten. Gleichzeitig sorgt Diversität in jeglicher Form nachweislich für eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und macht die Unternehmen als Arbeitgeber attraktiver.
Behinderte Menschen als Arbeitgeber
Behinderte Menschen werden in unserer Gesellschaft vielfach als bloßer Kostenfaktor gesehen. Dass Menschen mit Behinderung auch Potential oder gar einen großen Nutzen für die Allgemeinheit haben können, bleibt bei dieser Sichtweise ungesehen. Hier sollte man Folgendes bedenken: Menschen mit Behinderung schaffen auch Arbeitsplätze. Sie haben Bedarf an PflegerInnen, AssistentInnen und InklusionslehrerInnen und sind zugleich KonsumentInnen mit speziellem Bedarf. In einer Welt, in der die Technik und das Internet der Dinge auch Menschen ohne Behinderung den Alltag erleichtern sollen, sind sie sogar besonders interessante AbnehmerInnen. Beispiele sind hier: Diktierfunktionen für Handys und Computer oder Kühlschränke, die automatisch Produkte nachbestellen, die dann idealerweise direkt ins Haus geliefert werden.
Unser aller Blick sollte sich weg vom defizitorientierten Denken – hin zu den individuellen Stärken und Potentialen jedes Einzelnen bewegen. Die dadurch entstehende Inklusion in Arbeitswelt und Alltag könnte behinderten wie nicht behinderten Menschen neue Horizonte eröffnen.
(sb)
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 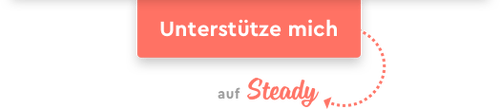
Foto: Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de
March 17, 2018
Vorurteile zum Thema Inklusion
[image error]
Auf Veranstaltungen zum Thema Inklusion stelle ich mich gerne so vor: „Schon als Kind hatte ich viel Kontakt zu Menschen ohne Behinderung. Mich hat immer inspiriert, wie viel Lebensfreude sie ausstrahlen und wie gut sie ihr Leben meistern. Seitdem ist es für mich ganz normal, dass es auch Nichtbehinderte gibt.“
Weil es immer noch merkwürdig klingt, wenn ein behinderter Mensch so etwas erzählt – scheint es mit der Inklusion noch nicht so ganz geklappt zu haben.
Viele Vorurteile geistern gegenüber der Idee der Inklusion durch die Welt. Wenn ich auf Vorträgen, in Schulen und auf Konferenzen darüber rede, merke ich, wie dehnbar und biegsam dieser Begriff „Inklusion“ ist. Und wie viele Vorbehalte und negative Assoziationen damit verbunden sind. „Inklusion ist eine gute Sache, aber…“, heißt es dann oft.
Ein häufig gehörtes Vorurteil ist, dass es bei Inklusion ausschließlich um das Thema Schule geht. Der Aspekt ist zwar wichtig, aber tatsächlich bezieht sich Inklusion auf alle Lebensbereiche. Inklusion ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und ein Menschenrecht. In der UN-Behindertenrechtskonvention wurde bereits 2009 klar festgelegt, wie Inklusion stattzufinden hat. Nach fast zehn Jahren wird in Deutschland aber immer noch so getan, als wäre Inklusion etwas Optionales, eine nette Zusatzgeschichte, die man machen kann, wenn noch Geld und/oder Zeit übrig ist.
Und das ist auch das größte Vorurteil zum Thema Inklusion: Dass Inklusion optional ist.
Aber kommen wir zurück zum Beispiel „Schule“: Warum kann Inklusion hier scheinbar nicht funktionieren? Die Vorurteile sind mannigfaltig.
Inklusion würde „den normalen Kindern schaden“, denn Kinder mit Behinderung „hemmen das Lerntempo der gesamten Klasse“. „Behinderte Schülerinnen nehmen zuviel Zeit und Kraft der Lehrenden in Anspruch, nichtbehinderte Kinder werden notgedrungen vernachlässigt“. Allerdings funktioniert für Inklusions-Gegnerinnen auch der Umkehrschluss: „Inklusion ist schädlich für behinderte Kinder“, weil diese an Regelschulen „maßlos überfordert sind“ und „hier nicht gefördert werden können“.
Außerdem hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass behinderte Schüler, die auf nichtbehinderte Kinder treffen, sich plötzlich ihrer defizitären Situation bewusst werden: „Die fühlen sich doch erst als Außenseiter, wenn sie jeden Tag erleben müssen, dass sie anders sind“ und „ständig Hilfe brauchen, alle auf sie warten müssen“.
Behinderte Kinder sollten „Schutzräume haben“, idealerweise an „Förderschulen, in denen sie unter sich sind – auch um sie vor Mobbing zu schützen“.
Auch für Lehrerinnen ist Inklusion eine Katastrophe: „Inklusion überfordert Lehrerinnen/Erzieher*innen, denn sie sind nicht für Kinder mit Behinderung ausgebildet“. „Inklusion geht zu Lasten aller Beteiligten, bringt somit keiner Seite Nutzen.“
Schließlich ist Inklusion natürlich „viel zu teuer“. Alles also eine Lose-Lose-Situation?
Alle diese Vorurteile basieren auf der Vorstellung, bei behinderten Menschen handele es sich grundsätzlich eine homogene und ausschließlich defizitäre Gruppe. Dass es auch Hochbegabte und Schnelllerner mit einer Behinderung gibt, kommt in dieser Denkweise nicht vor. Ebenso wenig wird differenziert, dass Behinderungen vollkommen unterschiedlich sind: Es Körperbehinderungen unterschiedlichster Ausprägung gibt, ebenso Sinnesbehinderungen, so genannte Lernbehinderungen usw. Und dass Schüler einen Behindertenausweis haben – obwohl in der Schulsituation überhaupt keine behindernden Umstände vorhanden sind, beispielsweise durch ausreichende Barrierefreiheit.
Behinderung ist nicht etwas vollkommen Statisches – sondern hängt vom Set und Setting ab. So kann ein Schüler mit einer Muskelerkrankung, der sich mit einem Rollstuhl fortbewegt, möglicherweise nicht an allen Disziplinen im Sportunterricht teilnehmen – erfährt im Klassenzimmer allerdings durch ausreichende Barrierefreiheit keine behindernden Umstände und benötigt keine zusätzliche Förderung.
Lisa Pfahl, Professorin für Disability Studies, forscht unter anderem über die Gründe der Ausgrenzung behinderter Menschen. Aussonderung von auffälligen Schülern hat laut Prof. Pfahl in Deutschland Geschichte. Die Vorstellung, homogene Lerngruppen seien die beste Lösung, ist tief verankert in den Köpfen vieler Pädagogen*innen. Auch wenn Erfolge an Schulen, die ein gegenteiliges Konzept verfolgen – zum Beispiel in Finnland – eine ganz andere Wirklichkeit präsentieren.
Bei einem inklusiven Schulsystem geht es um individuelle Förderung jedes Schulkindes. Ging es bei bei Schülerninnen mit Behinderung bisher um „sonderpädagogischen Förderbedarf“, steht jetzt Teilhabe und Abbau von Barrieren im Fokus – Punkte, von denen auch nichtbehinderte Schülerinnen profitieren. Die Bezeichnung „behindert“/“mit Förderbedarf“ und „nicht-behindert“/“ohne Förderbedarf“ spielen in einem inklusiven System keine Rolle mehr. Stattdessen werden Schüler als Individuen mit unterschiedlichen Potentialen wahrgenommen.
Andreas Hinz, Professor für Allgemeine Rehabilitations- und Integrationspädagogik, stellte fest: „Bereits aus frühen Untersuchungen in Integrationsklassen ist bekannt, dass die (…) Zuordnung von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf mit der pädagogischen Realität individueller Unterstützungsbedarfe wenig zu tun hat.“
Als Beispiel: Ob eine Schülerin beispielsweise im Rollstuhl sitzt, sagt nichts über seineihre Mathematik-Kenntnisse aus.
Ein inklusives Schulsystem würde Schülerinnen nicht mehr in defizitäre Kategorien einteilen, sondern individuell betrachten, fördern und ermöglichen, Stärken und Interessen aktiv einzubringen. So würde aus dem vorurteilsbelasteten Schreckgespenst „Inklusion in der Schule“ eine Perspektive und immense Lernverbesserung für alle Schüler.
Zum Schluß möchte ich noch auf das oft gehörte Vorurteil „Inklusion ist Gleichmacherei“ eingehen und darauf mit einem Zitat von Fred Ziebarth antworten, Psychotherapeut und ehemaliger pädagogischer Koordinator der inklusiven Fläming-Grundschule, die ich besuchte: „Inklusion ist die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt.“
(sb)
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit Suse Bauer zuerst in leicht abgewandelter Form in „neues deutschland“ erschienen.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: [image error]
March 15, 2018
»Denkt daran, in die Sterne zu sehen – und nicht auf eure Füße.« (Stephen Hawking)
Stephen Hawking (* 1942 — † 2018)
Stephen Hawking ist tot.
Und es fühlt sich an, als wäre die Welt ein bisschen weiter entfernt vom Aufbruch ins All, ein bisschen ahnungsloser, was Antworten auf die großen Fragen der Menschheit betrifft und ein bisschen hoffnungsloser, wenn es um nachhaltige Lösungen für drängende Probleme geht.
Er wird als genialer Geist und Visionär im Gedächtnis der Menschen bleiben – ein Wissenschaftler, der wie ein Popstar gefeiert wurde.
Hawking selbst zweifelte immer wieder, ob er tatsächlich in erster Linie für seine wissenschaftliche Arbeit und intellektuellen Erfolge bekannt war – oder seinen Rollstuhl und seine Krankheit.
Fraglos war er weltweit der bekannteste Mensch mit Behinderung. Und er präsentierte sich in einer Weise, die ihn nicht als “armes Opfer” oder “schwachen, abhängigen Behinderten” darstellte – auch wenn die Presse ihn natürlich regelmäßig an “seinen Rollstuhl fesselte”.
Hawking pflegte eine offensive Umgangsweise mit seiner Behinderung und scheute die Öffentlichkeit nie. Im Gegenteil: Auftritte vor Publikum konnte er sehr gut und machten ihm Spaß.
Er spielte sich selbst in verschiedenen TV-Serien. Dabei ging er äußerst humorvoll mit seiner Behinderung um. Bei einem seiner Auftritte in der Serie “Die Simpsons” fiel er dem Schuldirektor, der meinte Hawking könne nicht für sich selbst reden, harsch ins Wort:
Ruhe! Ich brauche niemanden, der für mich spricht – ausser meinem Sprachcomputer.
Bei “Raumschiff Enterprise” spielte er in einer holografischen Simulation mit Isaac Newton, Albert Einstein und Data Poker – und gewann.
In der TV-Serie “The Big Bang Theory” hatte er mehrere Auftritte und brachte einen der Hauptcharaktere, der ihn tief verehrt, immer wieder zum verzweifeln. Es gibt in einigen Folgen sogar Späße auf Kosten seiner Computerstimme – Hawking blieb allerdings immer überlegen und hatte das letzte Wort.
Auch wenn Hawkings TV-Serien-Ausflüge einfach aus Spaß stattfanden – erreichte er als Mensch mit Behinderung damit ein Massenpublikum außerhalb der Wissenschafts-Bubble.
Ein Thema, das medial immer wieder diskutiert wurde, war seine Faszination am anderen Geschlecht – in einem Interview erzählte er, dass er die meiste Zeit damit verbringe, über Frauen nachzudenken: “Sie sind mir nach wie vor ein Rätsel.“
Er machte keinen Hehl daraus, sexuell aktiv zu sein und beschrieb die Ehe mit seiner zweiten Ehefrau als “leidenschaftlich und stürmisch.” Generell galt er als Frauenheld, der kaum eine Chance für einen Flirt ausließ.
Stephen Hawking wuchs in einem privilegierten, intellektuellen Elternhaus auf – umgeben von Massen an Büchern. Und so genial er sicher war, so hatte er als behinderter Mensch auch einfach Glück: Seine Eltern studierten beide in Oxford und waren als Freigeister bekannt. Ein Schulfreund erinnerte sich, wie ungewöhnlich er die Diskussionsthemen im Hause Hawking fand: Mit den Kindern wurde am Essenstisch über Abtreibung, Sex, Homosexualität und den Tod gesprochen. Hawking selbst erzählte, dass seine Eltern ihm beibrachten, alles zu hinterfragen und groß zu denken (“think big”) – nichts für unmöglich zu halten.
Es ist eine Erfahrung, die ich teile: Dass das Elternhaus für behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einen entscheidenden Einfluss auf das gesamte Leben hat. Ob ein Mensch mit Behinderung in einer Werkstatt oder an der Universität landet, hat nicht ausschließlich mit der Intelligenz des Einzelnen zu tun – sondern auch mit dem Weitblick und der Förderung der Eltern und dem Umfeld der Familie.
Was mich an Hawking immer faszinierte? Dass er seinen Gedanken keine Grenzen setzte. Dass er sich erlaubte, alles erstmal für möglich zu halten – bis es einen Gegenbeweis gab. Er sprach über Zeitreisen und machte einen witzigen Versuch zu dem Thema: Plante eine Party, verschickte die Einladungen aber im Nachhinein. Da niemand kam, wären Zeitreisen wohl nicht möglich.
Über Aliens und fand, man solle mit der Kontaktaufnahme vorsichtig sein – und die Gefahr von Künstlicher Intelligenz. Und plante mit Mini-Raumschiffen nach Alpha Centauri zu gelangen.
Was bleibt von Stephen Hawking für behinderte Menschen, Angehörige, Freunde und Alliierte?
Traut den Diagnosen der Ärzte*innen nur bedingt: Hawking hat die ihm prophezeite Lebenserwartung um mehr als 50 Jahre überlebt.
Lasst euch nicht sagen, was ihr könnt oder nicht – sondern setzt eure Grenzen selbst.
Steht zu eurer Sexualität – eine Behinderung hat meisten keinen Einfluss auf sexuelle Bedürfnisse.
“Wir sind alle verschieden, es gibt keinen Standard für einen Menschen, aber wir teilen alle den menschlichen Geist.” (Stephen Hawking in seiner Eröffnungsrede zu den Paralympics, 2012)
Und lacht so oft es geht: “Das Leben wäre tragisch, wenn es nicht lustig wäre.“ (Stephen Hawking)
(sb)
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit Suse Bauer erschienen. Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: [image error]
(Foto: Jim Campbell/Aero-News Network)
February 21, 2018
Wann du als behinderter Mensch über Assistenz nachdenken solltest.
[image error]
Assistentinnen und Assistenten können das Leben von Menschen mit Behinderung erleichtern. Bereiten alltägliche Situationen zunehmend Schwierigkeiten, lohnt es sich, über diese Form der Unterstützung nachzudenken.
Den wenigsten Menschen fällt es leicht, sich einzugestehen, dass sie bestimmte Dinge im Alltag nicht alleine erledigen können. Natürlich holen sie eine*n Klempner*in, wenn die Toilettenspülung nicht mehr funktioniert, oder lassen die brummende Waschmaschine von einem Profi reparieren. Wenn es aber um vermeintliche Kleinigkeiten geht, etwa eine Gardinenstange anzubringen, oder eine neue Kommode aufzubauen, bitten die Wenigsten um Hilfe. Vielleicht holen sie sich eine*n Freund*in als Unterstützung dazu.
Anders gestalten sich solche Aufgaben für Menschen mit Behinderung. Für sie kann es bereits eine unüberwindliche Hürde sein, auf Toilette zu gehen, die Geschirrspülmaschine auszuräumen oder den Müll raus zu bringen (hallo Stufen!) – von der Gardinenstange ganz zu schweigen. Damit sie so selbstbestimmt wie möglich leben können, benötigen einige behinderte Menschen Unterstützung durch Assistent*innen. Dazu müssen sie sich jedoch auch eingestehen, dass sie bestimmte Dinge nicht alleine bewältigen können – und das fällt Menschen mit mindestens genauso schwer, wie Menschen ohne Behinderung. (Ich weiß, wovon ich schreibe, denn ich habe selbst oft genug versucht, meine Behinderung zu ignorieren.)
Wann Assistenz hilfreich sein kann
Ob und wann eine helfende Hand sinnvoll ist, muss jede*r selbst entscheiden. Wer noch zögert, ob er oder sie Unterstützung braucht – oder möchte -, für den oder die lohnt sich möglicherweise eine Checkliste wie diese:
Wobei und wann brauchst du Unterstützung?
Ganz am Anfang steht die Frage, bei welchen Tätigkeiten und zu welcher Tageszeit man am ehesten Hilfe braucht. Nur so lässt sich auch jemand Passendes finden. (Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Artikel “Auf der Suche nach der passenden Assistenz – 11 Tipps für behinderte Menschen“.)
Stellen alltägliche Aufgaben wie Anziehen, Waschen, Kochen, Wäschewaschen oder Einkaufen bereits eine große Herausforderung für dich dar?
Hier können Assistent*innen genau die richtigen Ansprechpartner sein, denn bei Bedarf schmeißen sie den Haushalt nach den Vorstellungen des Assistenznehmers. Das heißt nicht, dass die Helfer*innen bessere Putzkräfte sind. Sie sollen einem vor allem dann unter die Arme greifen, wenn man diese Dinge alleine nicht oder nur mit sehr viel Mühe hinbekommt. Denn gerade diese vermeintlichen Kleinigkeiten nicht eigenständig bewältigen zu können, führt zu Frust und Unzufriedenheit.
Droht regelmäßige Verletzungsgefahr bei alltäglichen Dingen?
Für mich etwa kann es lebensgefährlich werden, wenn ich stürze. Deshalb benötige ich unter anderem Assistenz beim Duschen. Behinderungen sind ebenso vielfältig wie die Ressourcen, um mit ihnen umzugehen. Aber wenn sich jemand regelmäßig verletzt, ist unbedingt über Unterstützung nachzudenken. Dazu gehört übrigens auch, dass jemand seine tägliche Körperhygiene nicht bewältigen kann oder unter Unterernährung leidet, weil Einkauf, Kochen und Essen große Herausforderungen darstellen.
Nimmst du weniger am gesellschaftlichen Leben teil als früher und vereinsamt zusehends?
Manchmal ist es ein schleichender Prozess. Der regelmäßige Kinobesuch fällt immer häufiger aus, der Kontakt zu Freunden und zur Familie nimmt ab oder das einst so heißgeliebte Hobby wird nicht mehr ausgeübt. Für Menschen mit Behinderung ist es oft anstrengend, solche Aktivitäten zu organisieren – gerade, wenn sie Ablehnung erfahren haben oder immer wieder auf bauliche und gesellschaftliche Hürden stoßen. Soll heißen: Sie wurden beispielsweise abgewiesen, weil der Veranstaltungsort nicht behindertengerecht ist oder sie haben die Erfahrung gemacht, wie ermüdend es ist, ohne Hilfe mit dem Rollstuhl über die unebenen Wege des Tierparks zu fahren. Auch seinen Liebsten nicht zur Last fallen, wenn diese einem zum Beispiel beim Toiletten- oder Treppengang helfen oder Orte ohne Treppenstufen auswählen müssen. Wer jedoch aus solchen oder anderen Gründen zunehmend vereinsamt, wird über kurz oder lang unglücklich. Depressionen und Ablehnung der eigenen Behinderung können die Folge sein. Hier kann Assistenz helfen. Sie übernimmt nicht nur die Unterstützung auf hügeligen Wegen, sondern begleitet den oder die Assistenznehmer*in auch zu Freizeitaktivitäten oder hilft beim Toilettengang. Das Ziel: Ein so selbstbestimmtes Leben wie möglich zu leben.
Sind Angehörige und Freunde zunehmend überfordert?
Oft übernehmen Familienmitglieder und Freunde verschiedene Aufgaben, um dem behinderten Menschen zur Hand zu gehen. Doch für sie bedeutet das, verfügbar zu sein und ihre Freizeit zu opfern. Hiermit meine ich nicht, dass ein Kumpel, mit dem ich unterwegs bin, mal meinen Rollstuhl schiebt, sondern die alltäglichen Aufgaben wie Körperpflege oder Einkauf, die nicht behinderte Menschen ebenso wenig von ihren Freunden erledigen lassen. Denn das führt wiederum dazu, dass sich der behinderte Mensch fühlt, als stünde er in der Schuld seines Gegenübers. Mit seinem*r Assistenten*in ist dies etwas anderes. Zwischen Klient*in und Unterstützer*in herrscht ein professionelles Verhältnis. Der oder die Assistent*in wird vom Assistenznehmer bezahlt, um dessen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es entsteht somit keine emotionale Schuldigkeit.
Wie gesagt, ob professionelle Unterstützung sinnvoll ist, muss jeder individuell entscheiden. Aber in vielen Punkten kann eine Assistenz das Leben erleichtern – ohne, dass hierfür die Selbstbestimmung aufgegeben oder eigene Bedürfnisse eingeschränkt werden müssen. Assistenz kann die eigene Freiheit und somit Lebensqualität massiv steigern und ganz neue Möglichkeiten und Perspektiven ermöglichen. Treffen einer oder mehrere der genannten Punkte zu, ist es allemal eine Überlegung wert.
Aber, worauf solltest du achten, wenn du Assistenz brauchst? Wo beantragt man was? Wie findet man denn bloß die passende Assistenz?
Hier gibt es 11 Tipps für behinderte Menschen, die auf der Suche nach der passenden Assistenz sind.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: [image error]
(Foto: Andi Weiland | Sozialhelden e.V.)
February 17, 2018
KRAUTHAUSEN – face to face: Tan Çağlar, Comedian
In der Sendung “KRAUTHAUSEN – face to face” lade ich als Moderator Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende und Medienleute mit und ohne Behinderung zum Talk ein. In “face to face”-Gesprächen tausche ich mich mit einem jeweiligen Gast über künstlerisches Schaffen, persönliche Interessen und Lebenseinstellungen aus. Und natürlich geht es auch ab und zu um das Thema Inklusion.
Als dreizehnten Gast hatte ich den Comedian Tan Çağlar zu besuch
Zum Video mit Gebärdensprache hier entlang auch Verfügbar mit Audiodeskription (AD).
In dieser Ausgabe: Tan Çağlar.
Zu Gast bei KRAUTHAUSEN – face to face: Tan Caglar, Comedian, Schauspieler und ehemaliger Rollstuhl-Basketball-Profi.
Bei Raul Krauthausen unterhält er sich über seine Karriere als Entertainer und über die Notwendigkeit von Inklusion.
Mehr Infos:
tan-caglar.de
Erstausstrahlung: 17.02.2018, 9.30 Uhr, Sport 1
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: [image error]
February 13, 2018
Je anspruchsloser, desto besser
[image error]
Behinderte oder alte Menschen, die in Einrichtungen leben oder betreut werden, sind den Vorgaben des Personals oftmals hilflos ausgeliefert. Denn nur, wer im Alltag funktioniert, hält den Betrieb nicht auf. Aufgrund mangelnder Selbstreflexion sind sich die Pfleger*innen ihrer Machtposition jedoch nur selten bewusst – ein strukturelles Problem.
Abendessen in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung oder in einem Altersheim. Das Pflegepersonal bereitet acht Schälchen mit jeweils einem Klacks Margarine vor – für jede/n Bewohner*in eine. Sind diese leer, gibt es keinen Nachschub, aber es fragt auch kaum jemand danach. Soweit nichts Ungewöhnliches. Doch schaut man genauer hin, verdeutlicht dieses Beispiel bei Menschen mit Behinderung, das Volker Schulze-Weigmann in seinem Artikel “Unsere anspruchslosen Assistenznehmer” beschreibt, ein strukturelles Problem im Umgang mit behinderten Menschen: Das Pflegepersonal hat Macht über die Bewohner*innen. Begonnen bei der Margarine zieht sich dieses Ungleichgewicht zwischen Pflegenden und “Gepflegten” durch den Einrichtungsalltag. Egal, ob es um festgelegte Essens- oder Schlafenszeiten geht, um Gruppenaktivitäten, an denen alle teilnehmen müssen, oder um den vorgeschriebenen Ablauf in Sachen Duschplan. Raum für “Sonderwünsche” gibt es nicht. Ich weiß, wovon ich hier schreibe.
Verweigern Bewohner*innen sich den Vorgaben, etwa, weil sie gerne später ins Bett gehen oder zu einem anderen Zeitpunkt duschen würden, werden sie – bewusst oder unbewusst – abgestraft. Entweder, indem die Pfleger*innen ihre Wünsche ignorieren, den Duschgang wegen Zeitmangels streichen oder – im schlimmsten Fall – indem sie die Menschen mit Behinderung körperlich oder seelisch misshandeln. Erwachsene sind somit der Willkür jener ausgesetzt, die ihnen eigentlich im Alltag assistierend zur Hand gehen und ihnen das Leben erleichtern sollen.
Dass sich Bewohner*innen in der Regel selten den Heimvorschriften widersetzen und scheinbar stilles Einverständnis signalisieren, verdeutlicht nur, dass sie an die institutionellen Strukturen gewöhnt sind – manche von ihnen bereits seit Kindertagen. Durch Vorgaben und eingefahrene Abläufe geben sie ihre Entscheidungsfreiheit auf. Nach und nach mutieren kompetente, selbstbestimmte Menschen so zu Hilfeempfängern ohne eigenen Willen.
Strukturelle Probleme und fehlende Selbstreflexion
Natürlich sind nicht alle Pflegeheime gleich und in vielen ist das Personal um bestmögliche Unterstützung bemüht. Jedoch habe ich etwa im Rahmen des Heimexperiments Einrichtungen kennengelernt, in denen diese strukturellen Probleme existieren. Bösartigkeit möchte ich nicht unterstellen, denn in den meisten Fällen ist den Pfleger*innen ihre Machtposition nicht einmal bewusst. Auch sie kennen nichts anderes als die eingeschliffenen Abläufe und sind deshalb kaum in der Lage, ihre eigene Rolle zu reflektieren. Wenn sie jedoch automatisch davon ausgehen, die Heimbewohner seien mit der vorgegebenen Situation glücklich, laufen sie Gefahr, die Machtstrukturen zu ignorieren.
Es ist ein enormer Kraftakt, Selbstreflektion und -kritik zuzulassen. Und natürlich verkompliziert es den Alltag, jedem einzelnen individuell gerecht zu werden. Denn anspruchslose Bewohner, die keine Sonderwünsche haben, ihre Margarineportion verspeisen und um 20 Uhr das Licht löschen, ermöglichen einen planbaren Tagesablauf. In einem chronisch unterbesetzten Personalstab sind selbstbestimmte Menschen, die Forderungen und Wünsche formulieren, Sand im Getriebe der Pflegenden. Und das, obwohl die Bewohner*innen jedes Recht dazu hätten – schließlich sind sie zahlende Klient*innen.
In diesem Zusammenhang gehört auch das Argument, das häufig bei Menschen mit geistiger Behinderung hervorgebracht wird, dass diese nicht in der Lage seien, ihre Situation adäquat einzuschätzen, auf den Prüfstand. Im Sinne des Empowerments ist jede noch so kleine Entscheidung ernst zu nehmen. Menschen in Pflegesituationen, die darin bestärkt werden, ihre eigenen Wünsche zu artikulieren, können auch durch ein Kopfnicken, durch Zwinkern oder Abwehr zeigen, was sie möchten oder ablehnen. Hierbei ist es irrelevant, wie vermeintlich anspruchsvoll oder -los diese Entscheidung ist. Eine auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Assistenz, die dem Menschen Handlungsspielraum zugesteht, gibt ihm so nach und nach sein Selbstbewusstsein zurück – ein erster Schritt weg von der Fremdbestimmung, hin zur Assistenz, die unterstützend den Alltag erleichtern soll.
Individuelle Leistungsanbieter statt Pflegeimperien
Die Alten- und Behindertenhilfe muss zum Leistungsanbieter werden, der seine Assistenznehmer*innen wie mündige Klient*innen behandelt. Diese sollten beurteilen, welcher Anbieter ihren individuellen Wünschen am ehesten gerecht wird. Pflegeimperien, auch totale Institutionen genannt, in denen Förderschulen, Wohnheime sowie Berufsbildungswerke unter einem Dach versammelt sind, zeichnen sich zumeist durch miserable Betreuungsschlüssel aus. Die Folge sind die bereits beschriebenen Machtstrukturen im Pflegealltag. Um diese aufzubrechen, können ein inklusives Schulsystem, persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung sowie kleine Wohngruppen einen ersten Ansatz darstellen.
Darüber hinaus müssten Pfleger*innen bereits im Rahmen ihrer Heilpädagogik-Ausbildung auf die Schwierigkeiten der strukturellen Machtsituationen in Einrichtungen vorbereitet werden. Selbstreflexion und kritisches Hinterfragen bestehender Abläufe sollten selbstverständlich sein. Auch regelmäßige Supervisionen sowie ein reales Mitspracherecht der Menschen mit Behinderung sind wichtige Schritte, die eines zum Ziel haben: bevormundende Pflege durch Assistenz für mündige Erwachsene zu ersetzen.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: [image error]
February 10, 2018
Was die Behindertenrechtsbewegung von der Frauenrechtsbewegung lernen kann.
[image error]
Im Januar 2017 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Rechte behinderter Menschen stärken sollte: Das Bundesteilhabegesetz. Während der Entwicklung des Gesetzestextes wurde schnell offensichtlich, dass Behindertenrechtsaktivisten*innen und Politiker*innen jeweils sehr unterschiedliche Vorstellungen diesbezüglich hatten.
Und so gingen 2016 viele behinderte Menschen gemeinsam mit Alliierten auf die Straße und kämpften um ihre Rechte. Die Auswirkungen der Proteste waren allerdings ernüchternd – und so wurde schließlich ein Bundesteilhabegesetz verabschiedet, das Betroffene sehr enttäuschte: Die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention wurden in dem Gesetz nicht ausreichend umgesetzt.
Für die Behindertenrechtsbewegung heisst es jetzt: Sich sammeln und die nächsten Schritte planen. Der Blick auf die Frauenrechtsbewegung kann dabei helfen, allerdings auch desillusionieren…
Mehr als 200 Jahre sind vergangen, seitdem die Frauenrechtsbewegung sich während der französischen Revolution in Europa formierte. In der Zwischenzeit konnte die Bewegung große Erfolge erringen, es gab und gibt aber auch immer wieder herbe Rückschläge.
Die Behindertenrechtsbewegung ist in Deutschland weitaus jünger – sie hat ihre Ursprünge in den 1960/70er Jahren zeitgleich mit dem “Disability Rights Movement” in den USA und der zweiten Welle der Frauenrechtsbewegung.
Zentrale Themen der Frauenrechtsbewegung und der Blick auf die Rechte von Menschen mit Behinderung:
Wahlrecht
In Deutschland feiern wir in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum des Frauenwahlrechts. Einige Frauen dürfen allerdings bis heute nicht wählen: Insgesamt ca. 85.000 Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung haben nicht das Recht an der Wahl des Parlamentes teilzunehmen – ein Verstoß gegen die UN-Behindertenkonvention. Behindertenrechtsaktivisten*innen demonstrieren schon lange gegen diesen Wahlausschluss und das Deutsche Institut für Menschenrechte bewertet „die Wahlrechtsausschlüsse (als) einen diskriminierenden und unverhältnismäßigen Eingriff in das menschenrechtlich garantierte Recht zu wählen und gewählt zu werden (…)“.
Recht auf Bildung
In Deutschland fand 1908 die sogenannte Mädchenschulreform statt: Mädchen wurde endlich die gleiche Schulbildung wie Jungen ermöglicht. Weltweit sind Mädchen bis heute in vielen Ländern im Bereich der Bildung benachteiligt.
Für Schüler*nnen mit Behinderung soll inklusives Lernen gleiche Chancen schaffen wie für nichtbehinderte Lernende – das fordert die UN-Behindertenrechtskonvention. Obwohl schon vor 10 Jahren das Ende der Förderschulen prophezeit wurde, ist davon heute nach wie vor wenig zu bemerken. Der Begriff Inklusion ist zum Schreckgespenst des Schulwesens geworden. Man hält Inklusion für nicht machbar, zu teuer, fordert Schutz der nichtbehinderten ebenso wie der behinderten Schüler*innen.
Und so bleibt der Bildungsweg vieler Menschen mit Behinderung auf Sondereinrichtungen beschränkt: Von der Förderschule ins Berufsbildungswerk und schließlich in die Behindertenwerkstatt. Zwei Drittel aller Schüler*innen an Förderschulen beenden die Schullaufbahn ohne berufsqualifizierenden Schulabschluss. Internationale Studien beweisen, dass inklusive Bildung behinderte Lernende besser und nachhaltiger auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.
Recht auf Arbeit
Erst die Industrialisierung ermöglichte Frauen berufliche Perspektiven. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts standen Frauen einige wenige Berufe offen, unter anderem konnten sie Lehrerin werden. Allerdings nur, wenn sie ledig waren. Sobald sie heirateten, hatte das die sofortige Kündigung zur Folge. Noch bis 1977 durfte eine verheiratete Frau nur dann erwerbstätig sein, wenn “dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar” war.
Selbst mit qualifizierter Berufsausbildung bleibt der erste Arbeitsmarkt Menschen mit Behinderung oft verschlossen, weil sie, laut Diskriminierungsbericht der Bundesregierung, bei der Besetzung von Stellen benachteiligt werden.
Vielen behinderten Menschen bleibt nur die Arbeit in Behindertenwerkstätten. Die UN kritisiert das deutsche Werkstättensystem, weil Menschen mit Behinderung aussortiert werden und ein Jobwechsel an den ersten Arbeitsmarkt durch das System verhindert wird.
Gleichberechtigung
Viele Männer sind der Meinung, dass Frauen heutzutage gleichberechtigt sind und die Frauenrechtsbewegung damit obsolet wurde. Unter anderem #MeToo zeigt uns eindrücklich, dass dies nicht der Fall ist.
Auch Menschen mit Behinderung sind weit davon entfernt, gleichberechtigt in dieser Gesellschaft leben zu können. Teilhabe behinderter Menschen und Barrierefreiheit sind nach wie vor “nice to have” – etwas, das man sich “leisten” kann, wenn es nicht “zu teuer” oder “zu aufwendig” wird.
Behindert werden und behindert sein
Die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir schrieb: „On ne naît pas femme, on le devient.” – „Man ist nicht als Frau geboren, man wird es.“ Eine Erkenntnis, die sich ebenfalls auf Menschen mit Behinderung übertragen lässt.
Ich wurde mit einem Körper geboren, der nicht der Norm entspricht und der in einer Welt, die für genormte Körper gebaut wurde, nicht ohne Hilfsmittel existieren kann. Der entscheidende Punkt ist nicht die Andersartigkeit meines Körpers – sondern die fehlende Barrierefreiheit. Die Gesellschaft entschied bisher, dass eine barrierefreie Umgebung nicht wichtig ist. Würden die mich behindernden Umstände durch Barrierefreiheit wegfallen, hätte das Thema Behinderung keine Relevanz mehr.
Ich wurde nicht nur als behinderter Mensch geboren, ich werde dazu gemacht.
Die nigerianische Autorin und Feministin Chimamanda Ngozi Adichie betont, dass soziale Normen von Menschen geschaffen werden, deshalb sollten Frauen und Mädchen scheinbar biologische Gründe für soziale Normen nicht akzeptieren.
Auch für die Behindertenrechtsbewegung ist dies ein wichtiger Aspekt: Wie oft schon wurde nicht existierende Gleichberechtigung behinderter Menschen auf ihre biologische Unterlegenheit geschoben. Es gibt keine biologische Unterlegenheit von behinderten Menschen gegenüber nichtbehinderten Menschen. Allerdings gibt es gesellschaftliche Werte, die den nichtbehinderten Menschen zur Norm erklären, die alles, was von diesem Maßstab abfällt, als degeneriert, unnormal oder minderwertig bewerten.
Wir Menschen mit Behinderung und unsere Alliierten dürfen dies nicht weiter hinnehmen und müssen klarstellen: Jede soziale Norm kann verändert werden!
So wie Chimamanda Ngozi Adichie zu Recht sagt, dass die menschengemachte Kultur verändert werden muss, wenn diese Frauen nach wie vor benachteiligt, muss ebenfalls unsere behindertenfeindliche, ableistischen und nicht barrierefreie Kultur und Umwelt verändert werden, um allen Menschen gleiche Teilhabe und Rechte zu ermöglichen.
Ich stimme Chimamanda Ngozi Adichie zu: Wir sollten alle Feministen*innen sein. Und möchte ergänzen: Teilhabe und Barrierefreiheit sollten nicht mehr als “nice to have” angesehen werden – sondern als unbedingte Notwendigkeit gleichberechtigten Zusammenlebens.
(sb)
Dieser Artikel ist zuerst, in leicht abgewandelter Form in “neues deutschland” erschienen.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: [image error]
Photo: Jonas Deister | Gesellschaftsbilder.de





