Christina Widmann's Blog, page 13
December 8, 2019
Langsam, locker, langweilig
Lieber Herr Strunz,
was ist Laufen "wie im Flow"? In diesen Flow
wollen Sie mir doch hineinhelfen mit dem ganzen dritten Teil des
Buches. Oder soll ich nur so tun als ob? Ist das vielleicht das ganze
Geheimnis dieses sogenannten Flow, grinsend so tun als ob?
Im ersten Drittel fangen wir zu laufen an. Auf einem Foto joggen Sie auf uns zu, mit einer hübschen Dame neben sich. Die Botschaft: Laufen ist sexy. Aber auch: Laufen ist künstlich, denn so gleichmäßig braun wie Sie werde ich draußen nicht. Blickdiagnose: Solarium. Vor dem Hautkrebs haben Sie keine Angst, dem laufen Sie davon. Laufen ist Ihre Wunderpille. Im Vorwort und immer wieder beten Sie es vor: Laufen schützt vor jeder Krankheit. Wissenschaft, schreiben Sie. Falsch, habe ich Ihnen vor zwei Wochen erklärt in der Rezension zu Ihrem anderen Buch "Der Schlüssel zur Gesundheit." Auf der Laufstrecke trifft man nur gesunde Leute, das stimmt - weil die Kranken daheim bleiben. Vorsortierte Stichprobe. Solche Studien sagen nichts über Ursache und Wirkung. Aber diesmal nennen Sie gar keine Studien oder Quellen. Was Sie an Zahlen behaupten, soll ich Ihnen einfach glauben.
Zwischen Ihren Texten haben Sie Seiten frei gelassen, wo der Leser ein Lauftagebuch anlegen kann. Vom eBuch führen Links zu Ihrer Internetseite, ich soll mir die Blätter ausdrucken. Ich habe stattdessen ein Notizbuch geführt. Wenn ich 28 Tage lang laufe, schreiben Sie, bekomme ich einen Lauf-Reflex, so wie viele Leute einen Frühstücksei-Reflex haben. Den Unterschied zwischen einem Reflex und einer Gewohnheit sollten Sie kennen, Herr Dr. med.
Während ich vier Wochen lang jeden Tag mitschreibe, ob ich gelaufen bin (17 Tage ja, 11 Tage nein), lese ich weiter: Läufer-Gene. Der Mensch ist zum Laufen gemacht. Sie vielleicht. Ich nicht, sonst bräuchte ich keinen Schwerlast-Sport-Bh. Sie schreiben es selbst: Das wichtigste Läufer-Gen liegt auf dem Y-Chromosom. Sie erzählen von unseren Vorfahren, die einer Gazelle nachliefen, bis sie umfiel. Das waren die Männer. Die Frauen sind höchstens gegangen, mit einem Baby auf der Hüfte. Die meiste Zeit waren sie schwanger oder stillten oder beides. Da läuft es sich schlecht. Ich habe selber eine kleine Tochter in der Wiege. Ich wache auf, wenn sie ihre Morgenmilch fordert. Dann springe ich ohne Frühstück in die Laufschuhe, wie Sie es vorschreiben, jogge los - und komme nicht weit. Blutzucker im Keller nach dem Stillen. Nach ein paar Metern wird mir schwarz vor Augen. Zwei Tage habe ich es probiert, dann habe ich die Laufschuhe umgeparkt. Sie stehen jetzt nicht mehr neben dem Bett, sondern draußen an der Tür. Erst wird gefrühstückt, dann laufe ich los.
Aber halt, Sie bringen ein Rezept für einen Läufer-Smoothie. Also doch nicht nüchtern loslaufen? Der Smoothie besteht aus Limette, Avocado, Arganöl, Kokoswasser, Stevia, Feldsalat, Eiweißpulver und Minze. Ohne zu probieren kann ich Ihnen sagen, dass ich davon brechen müsste. Avocados sind ekelhaft, und Stevia schmeckt scheußlich. Drückt als Süßstoff außerdem den Blutzucker noch weiter hinunter und macht Heißhunger. Nur Feldsalat und Minze kann ich selber anbauen, die anderen Zutaten kommen mindestens aus Italien, wenn nicht aus den Tropen.
Langsam, locker, lächelnd, schreiben Sie, jeden Morgen eine halbe Stunde. Langsam und locker geht, lächelnd - nicht so sehr. In einer halben Stunde komme ich aus dieser Kleinstadt nicht heraus. Asphalt, Bürgersteig, Schotter in einem kleinen Park, immer die gleichen Straßen und Gassen. Blass am Horizont die Sierra Guara, wo ich vor vier Jahren einen Trail gelaufen bin. Da will ich wieder hin. Vor allem will ich hier raus.
Muss ich laufen? Darf ich nicht Rad fahren? Da sehe ich mehr Landschaft in einer halben Stunde. Oder schwimmen, das schont die Gelenke. Oder tanzen, da darf ich hübsche Kleider tragen. Ich möchte wandern, oder Volleyball spielen, oder eine Kampfsportart lernen. Sie schreiben, ich muss laufen. Langsam, locker, langweilig. Deshalb nur 17 von 28 Tagen.
In der ersten Woche lief ich viermal und bekam Seitenstechen. Ich war außer Form. Bei dem Test, den Sie empfehlen, dem Harvard-Step-Test, hatte ich trotzdem hundert Punkte am ersten Tag, wie ein Spitzensportler. Was stimmt da nicht?
Vier Wochen sollte ich einfach bloß laufen. Jetzt geht es los: Zeit und Strecke messen, Puls aufschreiben, sonstige Biofaktoren mit ins Tagebuch, Technik verfeinern. Kleine Schritte soll ich machen. Hängte sich der Nurmi nicht an fahrende Züge, damit seine Schritte länger wurden?
Eine Pulsuhr soll ich mir kaufen. Gut, mit einem neuen Spielzeug habe ich die Motivation, wieder hinauszujoggen in die ewig gleiche Stadt. Vier Läufe dauert es, bis ich den geheimnisvollen Grenzpuls gefunden habe. Dann stelle ich meine Pulsuhr auf ein Intervall ein: 145-160 Schläge. Am nächsten Morgen laufe ich wieder los. An der Haustür schalte ich die Uhr ein. "Piep!", schallt es sofort: Lauf! Ich möchte mich gemütlich warmlaufen, aber: "Piep!" alle zehn Sekunden. Keuchend lege ich einen Gang zu. "Piep!" Erst, als es bergauf geht, ist die Uhr zufrieden. Ich biege rechts ab auf eine ebene Straße. Fünf Minuten lang darf ich in Ruhe laufen. Aber an der zweiten Steigung schallt es: "Piep piep!" Zu schnell! Ich bremse. "Piep piep!" Ich bremse weiter. Aber so langsam kann ich den Hügel nicht hinaufzockeln, dass die blöde Pulsuhr Ruhe gäbe. Ich drehe um, laufe gemütlich bergab, schon bin ich der Uhr zu langsam. Muss ich an der Ampel warten, piept sie. Sticht mich die Lebensfreude und ich hüpfe im Park mit Anlauf über einen Stein, piep-piept sie. Wenn es nach der Uhr ginge, liefe ich Runden um den Sportplatz. Zehn Runden kosten einen IQ-Punkt.
"Iss roh, dann wirst du froh. Iss kalt, dann wirst du alt." Ja, vorzeitig alt. Rohkost-Veganer sind so unterernährt, dass ein Drittel der Frauen nicht menstruiert. Schon nach 1-3 Wochen werden die Immunzellen im Blut weniger. Rohkostler haben geringere Knochendichte, essen zu wenig Eiweiß und ihnen fehlt Vitamin B12. (Quellen hier, hier, hier, hier und hier.) Vegan soll ich nicht werden, schreiben Sie, sondern rohes Fleisch und rohen Fisch essen. Salmonella lässt grüßen. Vor einer halben Million Jahren fing der Mensch zu kochen an. Daran dürfte sich unser Körper angepasst haben. Wir haben einen Teil der Verdauung in den Kochtopf ausgelagert. Mit ein Grund, warum wir uns ein so großes, energiefressendes Gehirn leisten können.
Wer so weit gekommen ist in Ihrem Buch, der braucht das Laufen wie die Luft zum Atmen, schreiben Sie. Sport-Sucht ist eine Krankheit, wussten Sie das? Oft geht sie mit einer Essstörung einher, Magersucht oder Orthorexie. Mit beidem scheinen Sie mich anstecken zu wollen. Mich langweilt es immer noch, das Joggen. Ich soll eine Liste machen, schreiben Sie, mit Argumenten dafür und dagegen. Meine dafür-Liste ist kurz, die dagegen-Liste hat auf dem Papier nicht Platz. Ich lese weiter.
Noch ein Rezept: Rohkost-Eiweißriegel aus teurem Lupinenschrot, ekelhafter Mandel-"Milch", künstlichem Eiweißpulver und teurem Kokosblütenzucker. War Zucker nicht böse? Der Riegel wird bei 160 Grad gebacken. Doch nicht roh.
Serotonin vom Laufen macht glücklich, Serotonin von Schokolade ist schädliches Pseudo-Glück. Klebt am Serotoninmolekül ein Etikett, auf dem steht, wo es herkommt?
Sie werben für Quinoa und Amarant, diese angeblichen Superkörner. Die südamerikanischen Indios pflanzten Quinoa früher auf die schlechten Böden, wo sonst nichts wuchs. Auf guten Boden pflanzten sie Mais und Kartoffeln, die geben zehnmal so viel Ertrag. Heute säen große Agrofirmen Quinoa auf die guten Böden. Die Ernte schippern sie zu uns ins Reformhaus. Und die kleinen Leute haben weder Quinoa noch Mais noch Kartoffeln. Fortschritt.
Sie trinken aus Pfützen, schreiben Sie, als Mini-Impfung fürs Immunsystem. Haben Sie dazu eine Studie für mich, Herr Strunz? Stärkt Dreck das Immunsystem, oder muss man ein gutes Immunsystem mitbringen, um davon keinen Durchfall zu bekommen?
Faszienrollen. Haben unsere Vorfahren in der Savanne das gemacht? Mit denen argumentieren Sie sonst immer, diesmal nicht. Ausführliche Studien zum sogenannten Faszientraining gips noch nicht, so weit ich weiß. Schicken Sie mir Links, wenn Sie welche haben.
Noch ein Kochrezept: Gemüsesuppe. Wie bringen Sie dafür so viel Enthusiasmus auf?
Ich soll beim Laufen meditieren, schreiben Sie. Warum? Millionen Jahre der Evolution haben mir ein Hirn gegeben, das denken kann. Und ich soll es abschalten? Meditation entstresst, schreiben Sie. Tut sie nicht, Metastudie hier. Die meisten Untersuchungen darüber sind schlecht gemacht, noch eine Meta-Analyse hier. Meinen Blutdruck senken will ich auf keinen Fall, ich habe 90/50, während ich diese Rezension schreibe.
Ich soll ein Unsinnswort vor mich hin denken, schreiben Sie: iamon, iamon, iamon. Mein Linguistenhirn sucht Ähnlichkeiten und findet jamón, das spanische Wort für Schinken. Jamón, jamón, jamón. Jetzt habe ich Hunger.
Es wird nichts mit dem Flow, Herr Strunz. Die Pulsuhr liegt in einer Schublade, und da wird sie vorerst bleiben. Ich gehe jetzt nicht mehr laufen, sondern zum Krav Maga. Das entstresst.
Hochachtungsvoll
Christina Widmann de Fran
Der kleine Laufcoach: Laufen wie im Flow von Dr. med. Ulrich Strunz
erschienen: 2017 bei Heyne
Ich danke für ein Rezensionsexemplar.
ISBN: 978-3-453-60441-4
Erhältlich auf Amazon.de.
November 27, 2019
Quellen bitte, Herr Strunz!
Lieber Herr Strunz,
Sie sind ein Frohsinnsmediziner, schreiben Sie. Sie heilen den ganzen Menschen. Sie haben den Schlüssel zur Gesundheit. Aber fangen wir beim Anfang an: beim Urknall. Ob man gar so weit zurückgehen muss in einem Buch über die Gesundheit, ist wohl Geschmackssache. Liest sich jedenfalls angenehm, und nach ein paar Seiten sind wir bei den Genen. Sie wiederholen ein bisschen Schulbiologie mit uns. Dann kommt es: "Es gibt keine kausalen Zusammenhänge zwischen einem Gen und bestimmten Merkmalen oder Krankheiten." Nicht? Wirklich gar keine? Auch nicht bei der Bluterkrankheit, der Sichelzellanämie, der Mukoviszidose, dem familiären Retinoblastom und wie die Erbkrankheiten alle heißen? Sie sprechen von Epigenetik: Gene kann man an- und abschalten. Stimmt. Aber ich kann nur an- und abschalten, was ich habe. Wenn beide Exemplare eines bestimmten Gens kaputt sind, bekommt man Mukoviszidose. Da hilft die Epigenetik nichts.
Natürlich leben wir gesünder, wenn wir gesund essen und uns bewegen. Natürlich machen nicht die Gene dick, sondern die Chipstüte - außer bei genetisch bedingtem Leptinmangel. Das ist eine Erbkrankheit. Natürlich sollten wir nicht depressiv werden und auf den Krebs warten, wenn die Oma daran gestorben ist. Die Gene sind nicht alles. Aber sollten sie gar nichts sein? Kann man sie vergessen? Warum neigen dann meine Mutter und ich beide zu Eisenmangel, vertragen keinen Modeschmuck, hatten beide während unserer Schwangerschaften keine Morgenübelkeit, dafür Sodbrennen? Unsere Ernährung könnte unterschiedlicher kaum sein. Ich mache Sport, meine Mutter gartelt nur. Ein Einzelfall, sicher. Aber Sie erzählen auch lieber Patientengeschichten, als dass Sie wissenschaftliche Daten zeigen würden. Sie sagen es noch einmal: "Es gibt keine Gene, die Krankheiten automatisch auslösen." Doch, Herr Strunz, die gibt es.
Ultramarathonläufer werden seltener krank, schreiben Sie, und haben ein besseres Immunsystem als der Durchschnittsbürger. Aber was ist Ursache, was Wirkung? Trainiert das Laufen meine Abwehrzellen? Oder kommt ein immunschwacher Mensch nicht bis zum Ultramarathon, weil die ständigen Erkältungen ihn nicht trainieren lassen? Haben Sie eine Interventionsstudie für uns, Herr Strunz?
Für Krebs zitieren Sie eine Studie: Männer mit Prostatakarzinom leben nach der Diagnose länger, wenn sie Sport treiben. Aber die Forscher haben nur beobachtet und Statistiken berechnet. Was ist Ursache, was Wirkung? Bleiben manche Männer länger am Leben, weil sie laufen? Oder treiben die Gesünderen noch Sport, während die Kränkeren froh sind, wenn sie alleine vom Bett zum Badezimmer kommen? Beobachtungsstudien reichen nicht, Herr Strunz. Da können wir nicht wissen, ob der Sport den Krebs besiegt hat oder ob der Krebs vom Sport abhält.
Ah, doch, endlich zwei Interventionsstudien, bei denen Ärzte ihre Krebspatienten nach der Therapie überredeten, zum Sport zu gehen. Prof. Marion Kiechle von der Universitäts-Frauenklinik München soll an Brustkrebspatientinnen so eine Studie durchgeführt haben, schreiben Sie. Im Quellenverzeichnis Ihres Buches finde ich keine. Haben Sie einen Link für mich, Herr Strunz? Frau Prof. Kiechle hat über 500 Fachartikel geschrieben. Ich habe die Überschriften der neuesten hundert gelesen und keinen Artikel gefunden, der auf den ersten Blick Ihre Quelle sein könnte. Was ich allerdings gefunden habe: Eine Studie, in der Prof. Kiechle vergleicht, ob Sport in der Jugend (von 12 - 34 Jahren) das spätere Brustkrebsrisiko senkt bei Hochrisikopatientinnen mit BRCA1/2-Mutation. Ergebnis: "Overall, there was no significant association between total physical activity and subsequent breast cancer risk." Insgesamt kein Zusammenhang zwischen Bewegung und späterem Brustkrebsrisiko. Nur beim mäßigem Sport zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr fand sich eine statistisch signifikante Wirkung, allerdings mit riesigen Fehlerbalken. Das Paper finden Sie hier.
In einem anderen Paper, erschienen im Dezember 2017, schreibt Frau Prof. Kiechle: "Randomized trials investigating the impact of lifestyle
interventions on cancer prevention and prognosis in BRCA carriers are
still missing." Das heißt: Frau Prof. Kiechle hatte 2017 bei ihrer Arbeit mit Brustkrebs-Hochrisikopatientinnen noch keine Daten zur Wirkung von Sport und Ernährung. Das schreibt sie in der Einleitung zu einer kleinen Studie, in der sie untersucht, ob ein groß angelegtes Experiment überhaupt möglich ist. Von den 68 Teilnehmerinnen ihrer Pilotstudie blieben nur 55 ein Jahr lang dabei und kamen zu den Nachuntersuchungen. Von den 55 hatten wiederum 7 das Sport- und Ernährungsprogramm nicht durchgezogen. Nur 48 von 68 machten wirklich mit. Das bedeutet eine Ausfallrate von 29 %. Mich würde interessieren, warum 20 von 68 Teilnehmerinnen aus dieser kurzen Studie ausschieden: Weil ihnen die vorgeschriebene Mittelmeer-Diät nicht schmeckte? Weil sie keine Zeit hatten für den Sport? Weil es keinen Spaß machte? Weil sie keine Wirkung merkten? Oder weil sie zu krank waren?
Die andere Interventionsstudie, die Sie angeben, habe ich gefunden: hier. Sie schreiben, man hätte "668 Männer mit Darmkrebs nach Operation und Chemo überredet, wöchentlich sechs Stunden lang Sport zu treiben. Sanften Sport." Nein, Herr Strunz, das hat man nicht. Die Forscher haben lediglich Fragebögen verschickt. Genau wie oben beim Prostatakarzinom war es eine Beobachtungsstudie. Die sagt uns nichts über Ursache und Wirkung. Von sechs Stunden oder sanftem Sport ist nicht die Rede. Und genau wie beim Brustkrebs steht die Quelle nicht in Ihrem Buch. Ich schätze, Sie haben die Originalstudien nicht gelesen, nur irgendwo davon gehört.
Multiple Sklerose. Hier haben Sie keine Studie, sondern einen Einzelfall: Einer Patientin ging es besser, seitdem sie lief und Nahrungsergänzungsmittel einnahm. Aber funktioniert das bei allen MS-Patienten? Oder hatte die Frau zusätzlich einen Vitamin- oder Eisenmangel, der ihre Beschwerden schlimmer machte? Haben Sie Blutwerte zu dem Fall? Ich suche Quellen und finde hier eine Meta-Studie: MS-Patienten, die Sport treiben zwischen den Schüben, fühlen sich körperlich etwas besser, haben etwas stärkere Muskeln und fühlen sich etwas weniger hilflos. Weniger Schübe haben sie nicht. Das sieht nicht so aus, als ob man, wie Sie es darstellen, "der Multiplen Sklerose davonlaufen" könnte.
Zu den Herzkrankheiten haben Sie einen schwammigen Absatz und eine Tabelle. Das Cholesterin ist schuld, aber irgendwie doch nicht, die Gene sind schuld, aber irgendwie doch nicht, und mit Sport bekommt man jeden Risikofaktor "in den Griff". Weiter zum Hirn.
Wer mit einem Problem spazieren geht, der kommt auf bessere Lösungen als einer, der vor dem Schreibtisch sitzen bleibt. Ein Laufband hilft auch. Das ist schön. Da grabe ich nicht nach Quellen. Sportlich aktive Jugendliche, schreiben Sie weiter, sind weniger nervös und ängstlich, haben mehr Energie, sind glücklicher. Auch erwachsene Sportler sind weniger depressiv, mehr extrovertiert, und fühlen sich gesünder. Und wieder, Herr Strunz, sind wir bei Ursache und Wirkung. Nimmt uns Sport die Angst, oder trauen sich ängstliche Menschen weniger aus dem Haus? Gibt Sport uns Energie, oder treibt die Energie uns ins Grüne? Macht Sport uns extrovertiert, oder gehen extrovertierte Menschen lieber in den Sportverein? Hilft Sport gegen Depression, oder kommen depressive Menschen seltener auf die Beine? Hier hätte ich doch gerne Quellen, am besten randomisierte Interventionsstudien. Was Extraversion mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun haben soll, hat mir auch noch keiner erklärt.
Überfliegen wir kurz Ihr Quellenverzeichnis: Spiegel-Artikel, populärwissenschaftliche Bücher. Zum Beispiel von Ernst-Peter Fischer. Den hatten wir auf diesem Blog auch schon. Originalstudien sehe ich wenige in der Liste, und die wenigen handeln von Albatrossen statt Menschen. Hauptsächlich spielen Sie wissenschaftliche Flüsterpost: Jeder erzählt die Geschichten ein bisschen anders. Wer weiß, was in der Originalstudie stand? Sie nicht.
Ich soll Marathon laufen, schreiben Sie, denn Marathonläufer sind erfolgreicher. Sie verdienen mehr. Das ergibt eine Umfrage an der Ziellinie. Ich glaube eher, nur Reiche können Sich so viele teure Turnschuhe leisten, wie man beim Marathon-Training verschleißt. Von Sport-Bhs für uns Frauen ganz zu schweigen. Und nur Reiche haben die Zeit: Sie können jemanden bezahlen, der sich um ihr Haus, ihren Garten und ihre Kinder kümmert. Ein Luxusweibchen stört es außerdem weniger, wenn der Mann kaum zu Hause ist, sie hat ihn ja des Geldes wegen geheiratet. Der Normalverdiener muss seinen Rasen selber mähen, will mit den Kindern spielen, will gelegentlich etwas mit seiner Frau unternehmen. (Gemeinsam laufen, sagen Sie? Nicht, solange die Kinder klein sind.) Oder mit Freunden.
Ein Drittel aller Marathonläufer arbeitet in einer Führungsposition, schreiben Sie, und verwechseln wieder einmal Ursache mit Wirkung: Konkurrenztiere, Ehrgeizlinge, Einzelkämpfer gehen laufen und wollen die ersten sein. Teamfähige mögen Mannschaftssport lieber und spielen Fußball, Handball, Hockey. Genügsame Leute laufen vielleicht, aber brauchen keine Stoppuhr. Und es stimmt: Bescheidene, genügsame, angenehme Menschen arbeiten seltener in Führungspositionen. Aber als Freunde habe ich sie lieber.
Jetzt haben wir erst zwei Kapitel Ihres Buches gelesen, Herr Strunz, zwei von zehn, und die Liste der Schlampereien füllt drei Seiten. Sie werden mir verzeihen, dass ich den Rest nicht mehr so ausführlich behandle.
Das dritte Kapitel beginnt mit dem Essen. Muttermilch wäre arm an Kohlenhydraten - was? In 100 ml Muttermilch sind 7 Gramm Milchzucker. Kein anderes Säugetier hat so süße Milch wie wir. Warum? Es könnte an unserem Gehirn liegen, das frisst nämlich am liebsten Zucker. Den Rest des Kapitels überfliege ich nur noch. Sie verteufeln die Kohlenhydrate und erzählen von Einzelfällen. Wissenschaft ist das nicht. Sie empfehlen uns Meditation. Jedem hilft die nicht. Bei Studien darüber muss man genau auf die Ausfallrate schauen, denn wer sich langweilt oder keine Wirkung merkt, der geht nicht mehr hin. Aber Studien haben Sie keine gelesen.
Achtsamkeit, Glück im Jetzt, positives Denken. Das ist das Heftpflaster der Psychotherapie: Hilft bei Kleinigkeiten, wenn man sonst gesund ist. Wenn einer leidet - unter einer schweren körperlichen Krankheit oder einer schweren Depression - und Sie sagen: "Jammer nicht rum, denk positiv!", machen Sie es schlimmer.
"Woran leidet der Mensch? Leidet er wirklich an dem Diabetes, der Arterienverkalkung, leidet er am Schmerz? Nein, er leidet daran, wie er die Krankheit, die Schmerzen in seine Glaubenssätze einpasst." Hatten Sie schon einmal so richtig Zahnweh, Herr Strunz? Die Sorte, wo man an nichts anderes mehr denken kann? Oder wiederkehrende Muskelkrämpfe, Migräne, eine Gallenkolik? Glauben Sie mir, Herr Strunz, der Mensch leidet am Schmerz. Sonst würde er nicht nach Paracetamol greifen, sondern zu einem Selbsthilfebuch.
Natürlich kann man sich kleine Schmerzen groß machen, wenn man ihnen zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Natürlich habe ich ein Stück weit die Wahl, ob ich jammernd liegen bleibe oder ob ich mich aufraffe, mich ins Auto setze und eine halbe Stunde weit ins Krankenhaus fahre, weil niemand anderes da ist. Aber es tut dabei nicht weniger weh.
Schlaf ist gesund. Ja, so wie Sport und gesundes Essen. Binsenweisheit.
Aber nichts davon verhindert alle Krankheiten, wie Sie es darstellen.
Schrödingers Katze, zehn Dimensionen, Grenzen im Kopf. Sind Sie ein Arzt oder ein Guru, Herr Strunz? Altern ist eine schlechte Angewohnheit, schreibt er mit weißen Haaren, Halbglatze, Falten im Gesicht. Das Kapitel über Quantenphysik spare ich mir.
Wir sind durch, Herr Strunz, und haben festgestellt, dass Sie von Epigenetik wenig Ahnung haben, dass
Sie wissenschaftliche Daten aus zweiter und dritter Hand nehmen statt
aus den Originalstudien, dass die Frage nach Ursache und Wirkung Sie
nicht interessiert. Vor allem haben wir gesehen, dass Sie glauben, das
Laufen würde jede Krankheit verhindern. Und umgekehrt wäre jeder Kranke
selber schuld, egal ob er eine Erkältung hat oder Krebs oder Multiple
Sklerose, Herz-Kreislauf, Darm, Gehirn - selber schuld. Und bei jedem
kranken Kind die Eltern. Das nennen Sie Frohsinnsmedizin? Ich nenne es Quacksalberei.
Hochachtungsvoll
Christina Widmann de Fran
Der Schlüssel zur Gesundheit: Erfahrungen und Überzeugungen eines passionierten Arztes von Dr. med. Ulrich Strunz
Erschienen: 2016 beim Heyne-Verlag, dem ich für ein Rezensionsexemplar danke.
Erhältlich auf Amazon.de.
Mehr von und über Ulrich Strunz auf www.strunz.com.
November 25, 2019
Irene Vallejo: El infinito en un junco
Muy Autora mía,
El infinito en un junco me ha encantado. ¿Y cómo no? Nos lleva al paraíso perdido, la biblioteca de Alejandría. Nos lleva a las orillas del Nilo a cortar juncos para el papiro, a Pérgamo para escribir sobre piel. Con imaginación de niña y voz de cuentacuentos usted enlaza citas y anéctodas con viñetas pormenorizadas de la vida antigua. Saltamos al presente a menudo. Un libro lleva a otro, ningún autor es una isla. Usted nos presenta a los griegos que inventaron la literatura y a los romanos que fielmente los copiaron. A Cicerón, Horacio, Plauto y demás usted les diagnostica un complejo de inferioridad cultural. Ellos mismos lo decian: lo único propio de los romanos fue la risa, la sátira. Satura quidem tota nostra est, escribió Quintiliano. Me habría gustado un parrafito sobre este invento irreverente.
A pesar de todos los saltos usted mantiene unido el texto. Desde El nombre de la rosa, desde la biblioteca distópica de Borges, desde los campos de concentración, desde las hogueras de libros quemados volvemos siempre a la historia que usted cuenta lentamente, la historia del libro y del lector. Perdemos el paraíso de la Gran Biblioteca, pero seguimos la senda de los libros hasta las bibliotecas públicas de hoy. Solamente al final leemos unas páginas que no encajaban en otro sitio, pero que tampoco encajan al final: usted nos presenta a los romanos antiguos como unos grandes integradores en un imperio donde nadie "habría entendido nuestros conceptos modernos de inmigrantes ilegales o sin papeles." ¿Quién construyó el limes, quién el muro de Adriano? Los romanos a ningún extranjero le daban la vivienda gratis ni la impunidad jurídica. Es cierto: no lo habrían entendido. A los de fuera los compraban y vendían igual que a reses. Con la gente de dentro del imperio eran más clasistas que racistas los romanos. Me imagino que se comportaban más o menos como lo hacemos hoy los alemanes con los inmigrantes desde la demás Comunidad Europea, nuestro imperio sigiloso.
Los progresistas de hoy solemos despreciar a los opresores, a la clase alta. Sin embargo, los escritores clásicos que tanto nos gustan eran los mandamases y los ricachones de su época, y los enchufados a ellos. La gente de la calle no leía ni escribía. Sabemos poco sobre cómo vivían. Usted lo menciona. Sin embargo, nos cuenta el cuento de las mujeres oprimidas que eran casadas y divorciadas como a los varones les gustase. Sí lo eran: las mujeres de clase alta, una pequeña minoría. Nada sabemos sobre cómo vivían las mujeres de clase baja. Petronio deja entrever que los esclavos se emparejaban por amor si el amo los dejaba, y que a veces las parejas eran manumitidas juntas.
Ya antes, desde el principio del libro, usted quiere ver la antigüedad a través de las lentes del feminismo moderno. También las páginas acerca de Safo y Enheduanna se leen sexistas. El primer texto que tenemos firmado lo firmó mujer. ¿No significa que los hombres - si hombres fueron quienes inventaron la escritura - enseguida la enseñaron a sus hijas? Pero usted lo llama un comienzo inesperado. Luego se lamenta de que las mujeres no tuviesen derecho a hablar en público ni a desempeñar cargos políticos. Tampoco lo tenía la gran mayoría de los varones. Las mujeres de clase alta tenían lo que hoy llamamos los problemas del primer mundo, problemas de lujo. En las clases bajas, o sea, en casi toda la población, hombres y mujeres juntos luchaban para sobrevivir el invierno, para sacar adelante a los hijos, para reconstruir las aldeas saqueadas en las interminables guerras.
La igualdad de todas las personas - el derecho a voto, la educación gratuita y universal - son inventos recientes que los varones, a poco que los habían conquistado para sí, han compartido con nosotras. En un libro acerca del mundo antiguo no hay por qué meter con calzador el feminismo. Desentona en una obra por lo demás tan bien documentada. Me da pena que El infinito en un junco, este canto de amor - al libro, a la cultura, a las humanidades y la humanidad - lleve notas de odio. Que usted, tan buena cuentacuentos, dedique su pluma a perpetuar el rencor.
Atentamente
Christina Widmann de Fran
El infinito en un junco: La invención de los libros en el mundo antiguo. Ensayo de Irene Vallejo Moreu.
Publicado en 2019 por Ediciones Siruela.
ISBN: 978-84-17860-79-0
Disponible en Amazon.es
November 13, 2019
Irene Vallejo: El silbido del arquero
Muy Autora mía:
He leído primero la novela, dejando para después el ensayo El infinito en un junco que usted presentó la semana pasada en la librería Ibor en Barbastro. Usted nos cuenta la historia de Eneas y la reina Elisa, también llamada Dido, en la recién fundada Cartago. Es el comienzo de la Eneida. Usted lo ha cambiado de mensaje: Eneas ya no sigue por piedad la llamada del dios que le manda zarpar hacia Italia. Sigue su anhelo de paz y su miedo de una nueva guerra. Cobarde, deja Cartago cuando los nómadas del desierto se acercan para asediar la ciudad. El silbido del arquero es una historia de derrotas, de malentendidos, de flaqueza humana. Un dios de los griegos envidia a los humanos justo por ello, por lo efímeros que somos. En un segundo hilo, el poeta Virgilio tiene miedo del encargo que ha aceptado del emperador Augusto. Tiene que escribir la Eneida y no sabe por dónde empezar.
Para la Cartago de la novela usted se ha fiado de su imaginación. Se le ha colado un anacronismo: Elisa se baña con jabón. Aunque los babilonios y los antiguos egipcios ya sabían hacer jabón, no lo usaban para lavarse. Es improbable que los fenicios lo hicieran. Todavía Plinio el Viejo describe que los galos y germanos utilizaban jabón a modo de pomada para el cabello.
Yulo y Ana, los únicos niños de la novela, juegan con huesos de cereza y cáscaras de nuez. Cerezas sí había en África septentrional por aquellas fechas, pero de las nueces no estoy segura. El nogal viene de Asia. Poco a poco los hombres lo fueron llevando a otros países. En tiempos de Eneas había nogales en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. En Cartago, donde hoy está Túnez - no sé. En todo caso es un pormenorcito.
El silbido del arquero es agradable de leer. Usted cuida el lenguaje, el ritmo, el sonido de las palabras. Por ejemplo, no es el arquero quien silba, es el arco. Pero "El silbido del arco" sonaría flojo. El silbido del arquero es simétrico, suena bien. Así en todo el libro las frases suenan a poesía, a cuento contado al amor del fuego. No me sorprende que la novela vaya por la tercera reimpresión.
Atentamente
Christina Widmann de Fran
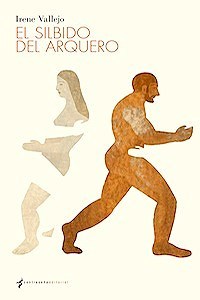
El silbido del arquero de Irene Vallejo Moreu
primera edición: 2015, Contraseña Editorial.
ISBN: 978 84 940903 7 0
Disponible en Amazon.es.
November 8, 2019
Offener Brief an den ÖDP-Bundesverband
Sehr geehrter Herr Raabs, sehr geehrte Damen und Herren,
Im aktuellen Newsletter der ÖDP sehe ich einen Aufruf zum Klimastreik am letzten Novemberwochenende. Ich möchte Sie bitten, diesen Aufruf zurückzunehmen. Die ökologisch-demokratische Partei muss sich von der Fridays4Future-Bewegung, von Extinction Rebellion und ähnlichen Gruppen kilometerweit distanzieren oder aber das Ö und das D aus unserem Namen streichen.
Extinction Rebellion fordert, dass ungewählte Bürgerversammlungen die Umweltpolitik bestimmen sollen. Das darf es in einem demokratischen Verfassungsstaat nicht geben. Diese Versammlungen wären weder repräsentativ noch legitimiert. Wer bestimmt, welche Bürger in der Versammlung sitzen? Derjenige hätte diktatorische Macht über die Energiepolitik und damit über die gesamte Wirtschaft.
Die Fridays4Future-Bewegung fordert vielerlei. Sie will ein Klimaziel erreichen, das ein einziger Wissenschaftler willkürlich festgelegt hat. Sie deutet auf Klimakurven, die berechnet wurden mit denselben Computermodellen, die nicht voraussagen können, ob es nächste Woche regnet. Sie fordert Aufklärung und meint Panikmache bezüglich eingebildeter Permafrost-Kipppunkte. Im Mittelalter konnte man in Nordhessen Wein anbauen, in einer hübschen Kleinstadt, die auf Kirschbäume umrüsten musste, weil es heute für Wein zu kalt ist. Noch wärmer war es vor 5.000 bis 8.000 Jahren während des sogenannten Holozän-Klimaoptimums. Damals verdunstete mehr Wasser aus dem Ozean, es regnete mehr, und wo heute die Sahara ist, lebten Nilpferde. "Damals gab es keine sieben Milliarden Menschen," hält F4F dagegen. Aber woher sollen der Regen oder der Permafrost wissen, wie viele Menschen es gibt? Was passiert, wenn man im hohen Norden den Boden auftaut, untersucht eine Gruppe von Forschern seit einigen Jahren in Alaska. In den ersten vier Jahren nimmt er CO2 auf. Dann gibt er kleine Mengen ab, aber nicht annähernd das, was die Klimaforscher früher befürchtet haben. Wärmer bedeutet feuchter, mehr CO2 bedeutet bessere Ernten - das lässt F4F in seiner "Aufklärung" unerklärlicherweise weg.
F4F fordert, die Kohlekraft herunterzufahren und bald ganz abzuschalten. Wir haben in Deutschland keinen Ersatz für fossile Brennstoffe, außer der Atomkraft. Wollen wir weiterhin zuverlässig Strom für Licht, Kühlschränke und alles andere haben, dann müssen wir bei der Kohle bleiben oder Öl und Erdgas verbrennen, was auf dasselbe hinausläuft. Sonst machen wir uns abhängig von Importstrom, also von Atomkraftwerken in Frankreich und Polen. Schon jetzt macht Deutschlands hoher Anteil an Windenergie das europäische Stromnetz instabil. Wind- und Sonnenenergie sind außerdem große Umweltzerstörer, wenn man mitrechnet, was Herstellung und Entsorgung kosten: Für ein Windrad müssen dieselbetriebene Maschinen viele Tonnen Eisenerz aus einem Berg brechen, in Hochöfen muss man es schmelzen, in Fabriken schmieden. Dieselbetriebene Tieflader fahren die Bauteile auf eine Hügelkuppe, wo dieselbetriebene Maschinen abgeholzt, planiert und betoniert haben. Ein dieselbetriebener Autokran stellt das Windrad auf. Nach etwa zwanzig Jahren muss ein dieselbetriebener Autokran es wieder abbauen, dieselbetriebene Tieflader müssen die Teile wegschaffen. Stahl wird wiederverwertet, aber die Flügel aus Glasfaser muss man entweder unter riesigem Energieaufwand zerkleinern oder man vergräbt sie mit einem dieselbetriebenen Bagger. All das für unzuverlässigen Strom, der mit jedem Betriebsjahr weniger wird. Photovoltaikplatten muss man im Giftmüll entsorgen, sonst geben sie Schwermetalle an den Boden ab. Recycling ist zu teuer, es lohnt sich nicht. Für bestimmte Sorten von Photovoltaikplatten ist noch gar kein Recyclingverfahren erfunden. Auch das ignorieren die Kosten-Nutzen-Rechnungen bis jetzt.
Anstatt zu streiken und Unmögliches zu fordern, sollten wir die Kinder aufrufen, in die Schule zu gehen und Ingenieure zu werden, damit sie die grünen Energien der Zukunft erfinden können. Noch haben wir keine.
Hochachtungsvoll
Christina Widmann
November 4, 2019
Jonathan Stroud: The Amulet of Samarkand
Dear Author,
I read a German translation of The Amulet of Samarkand about ten years ago. Yesterday I finally read the original. I still remembered the ending. Nevertheless, the tension gripped me again. And Bartimaeus' footnotes delight even more in their original language.
Since I read the whole trilogy in German, re-reading the first volume I noticed a few hints that you dropped early on: the golem's eye, Bartimaeus' remarks about Kitty and her friends. How far in advance did you plan the trilogy before you wrote it?
And a small detail: Can utukku materialize spears out of nothing? The two guards in the Tower have one each. One throws its spear, Jabor snaps it. A few paragraphs later the same utukku throws a spear again.
Yours sincerely
Christina Widmann de Fran
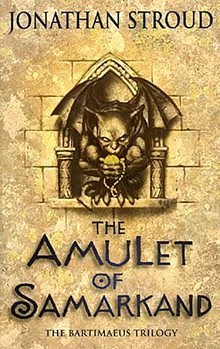
The Amulet of Samarkand: The Bartimaeus trilogy, book 1 by Jonathan Stroud
published in 2003
ISBN: 0-7868-1859-X
Get your copy on Amazon.co.uk.
October 31, 2019
Ramsey Voice Studio's "Master Your Voice" Online Singing Course- Midway Update
Dear Readers,
In September I started Matt Ramsey's online singing course Master Your Voice. I wanted to finish it in a month, but the planning fallacy hit me hard. Here's the midway update that I had promised you for October 1st.

What took me so long? Three things. First, if you're as far away from your goal as I was, you can't hope to become a perfect singer in a month. The second delay was my fault: I got stuck and then I got stubborn. The biggest problem with my voice was that it sounded breathy and weak. Master Your Voice has several exercises to fix that. When I got to the first of them, I did it over and over for a week and heard no progress. Instead, every evening my throat hurt like I'd been shouting. Frustrated, I moved on and noticed that the next video starts with: "If the first exercise doesn't work for you, try this: ..." And in case the second one doesn't do the trick, there's a third and a fourth. So I used the easiest exercise for vocal tone and did that for a week. While I did notice my voice get stronger, it was unbearably slow. Apart from frustrated, I got bored.
Luckily, at that point Matt Ramsey wrote me an e-mail and asked how the blog post was coming along. I told him where I was stuck and he answered with a two-minute video file. He told me not to get too fixed on any single section of the course, especially not on vocal tone. Many of the other exercises train that, too. So I finally moved on and noticed that yes, Matt was right: My voice has been slowly getting stronger while I had fun with other things, for example getting my range back.
Third, I got the flu. No singing when talking hurts.

What does Matt Ramsey make his students do? Silly things. I've been blowing raspberries, singing through a straw and hooting like an owl. Boring things, too: the same four or five scales over and over again with different syllables. It's nay, foo, fee, mum, gug, gee, nee, but always the same intervals. And only one breathing exercise. It works. It amazes me how much it works. But half an hour of warm-up with 25 minutes of one single scale, that's for people who practise the same song a hundred times until they get it right, not me.
Anyway, the fun part of singing is songs. Every section of Master Your Voice ends with a video about two songs. For guys there's Sam Smith, James Arthur, Shawn Mendes and other names that I hadn't heard before. (I'm a dinosaur, I know.) I had heard of Rihanna, P!nk and Beyonce. I even recognized most of the songs for girls. I'm not learning to sing them, though. Not my cup of tea. Matt explains what techniques to look for, so I went and looked for something good with those techniques. Art Garfunkel rules.

What have I learned so far?
What's left to learn? Vibrato. I've been looking forward to it ever since I saw it on the curriculum. I also need to get even stronger and smooth out my notes. Practise practise practise.
Here's what I sound like now:
For comparison, you can look at the video under my first blog post about Matt Ramsey's Master Your Voice singing course. Or don't. Spare your ears.
I'm going to post a full review when I'm finished with the lessons: in two weeks or whenever the planning fallacy lets me. Stay tuned!
Yours sincerely
Christina Widmann de Fran
October 26, 2019
Georg Koytek, Lizl Stein: Wien kann sehr kalt sein
Liebe Autoren,
eine späte Rezension schreibe ich Ihrem Kriminalroman Wien kann sehr kalt sein. Wie wenig das Buch taugt, haben die Leser schon bemerkt: Auf Goodreads hat es nur neun Sternebewertungen und einen einzigen, zwei Zeilen langen Kommentar. Nichts gewesen, bedeutet das für einen vier Jahre alten Roman. Vielleicht aber wollen Sie wissen, was Sie falsch gemacht haben.
Wien kann sehr kalt sein ist Teil einer Serie. Die beiden Ermittler, Polizistin und Ex-Kollege, haben eine Vorgeschichte miteinander. Die erzählen Sie ausführlich und im Plusquamperfekt, obwohl man sie weglassen könnte. In der Gegenwart fällt ein Schauspieler in eine Reihe offener Lanzen, das Publikum klatscht. Orsini lässt sich als Komparse anstellen und ermittelt verdeckt im Burgtheater. Der Fall hätte fesseln können, wenn Sie ihn schneller erzählten. Zwischenspiele aus dem Blickwinkel unbekannt herumschleichender Gestalten sollen Spannung schaffen. Stattdessen lassen sie mich gähnen.
Ein Roman besteht aus Szenen. In jeder Szene muss sich etwas verändern, sonst ist es ein Stilleben. Wien kann sehr kalt sein fehlt der Nervenkitzel. Nur der Schauplatz hat mir gefallen: Man merkt, dass Sie das Burgtheater von innen kennen.
Hochachtungsvoll
Christina Widmann de Fran
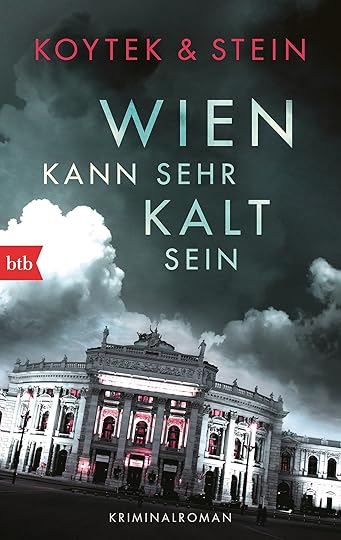
Wien kann sehr kalt sein: Kriminalroman von Georg Koytek und Lizl Stein
erschienen: 2015 bei btb
Ich danke für ein Rezensionsexemplar.
ISBN: 978-3-442-74996-6
Noch erhältlich auf Amazon.de.
October 20, 2019
Kai Kupferschmidt: Blau
Lieber Autor,
es gibt noch immer keine blauen Rosen, und jetzt weiß ich, warum. Sie erklären es leicht, auch die Physik und Chemie hinter den Farbstoffen in Tieren und Pflanzen. Wir folgen Ihnen über Kontinente, schauen mit Ihnen in den Himmel und in manches Mikroskop.
Sie erzählen, wie ein Alchimist auf der Suche nach einem Allheilmittel einen blauen Farbstoff fand - das Berliner Blau. Später schreiben Sie, dass Ultramarin, also Lapislazuli, das "Maß aller blauen Dinge" blieb, bis YInMn-Blau es vor zehn Jahren ersetzte. Warum? War wirklich jahrhundertelang kein Farbstoff so blau wie Ultramarin? Was ist mit Indigo? Auch zu diesem Blau - dem von Blue Jeans - erzählen Sie spannende Geschichten. Aber was blauer färbt, Indigo oder Ultramarin, das erzählen Sie nicht.
Aus dem Reich der Mineralien geht es zu den Tieren und Menschen. Auf Seite 77, unter dem Titel "Zapfenstreiche der Evolution" schreiben Sie, das Sehen wäre in der Geschichte des Lebens Dutzende Male unabhängig voneinander entstanden. Den Satz liest man in vielen Büchern, aber er ist veraltet: Anscheinend entstand das Auge nur einmal. Die Gene, die für Augen codieren, sind hochkonserviert. Pax6, das beim Menschen und bei der Maus bestimmt, wo in der Embryonalentwicklung die Augen angelegt werden, findet man fast identisch bei Drosophila. Säugetier-Pax6 kann bei Küken und Fliegen ektopische Augen wachsen lassen. Sogar bei Tintenfischen hat man ein Molekül gefunden, das Pax6 sehr ähnelt und dieselben Funktionen aufweist. Ein Paper dazu hier, Wikipedia hier. Die Retina ist evolutionär älter als das Gehirn.
Ansonsten liest sich das Kapitel übers Sehen gut und aufschlussreich. Sie erklären, was es mit dem Kleid auf sich hatte. Dann folgt der beste Teil des Buches. Blaue Farbstoffe sind schwer herzustellen, das haben Sie im ersten Teil erklärt. Ab Seite 97 zeigen Sie uns, wie Pflanzen und Tiere es trotzdem machen. Wer keinen Farbstoff hat, weiß sich anders zu helfen. Die strahlendsten Farben sind gar keine: Schmetterlinge haben gelernt, ganz gezielt zu schillern.
Wie blaue Augen entstehen, habe ich nicht ganz verstanden. Bei den Käfern und Schmetterlingen schreiben Sie, je dichter die Packung, desto blauer schillern sie. Aber für Melanin ist es umgekehrt: Je mehr, desto brauner. Die Augen mit dem wenigsten Melanin sind blau. Wie geht das, Herr Kupferschmidt?
Die Schmetterlinge, den blauen Himmel, den Eisvogel und den Enzian werde ich in Zukunft mit denselben Augen sehen wie früher, aber mit anderen Gedanken. Und sollte jemals eine blaue Rose auf den Markt kommen, werde ich rufen: "Das ist geschummelt!"
Hochachtungsvoll
Christina Widmann de Fran

Blau: Wie die Schönheit in die Welt kommt von Kai Kupferschmidt
erschienen am 7.10.2019 bei Hoffmann und Campe.
Ich danke für ein Rezensionsexemplar.
ISBN: 978-3-455-00639-1
Erhältlich auf Amazon.de .
October 12, 2019
Patrizia Schlosser: Im Untergrund
Liebe Autorin,
"Die gibt's noch, die RAF?" dachte ich, als ich den Klappentext zu Im Untergrund gesehen habe. Die Nachricht von 2016, dass drei mutmaßliche Terroristen jetzt Geldtransporter überfallen, habe ich nicht mitbekommen. Sie dagegen haben sich auf die Suche gemacht zusammen mit Ihrem Vater, einem pensionierten Polizisten, der 1972 beim Münchner Olympia-Attentat im Einsatz war.
Einerseits wollten Sie die letzten drei RAF-Terroristen finden, andererseits reichen Ihnen die Beweise nicht dafür, dass die drei überhaupt zur RAF gehörten. Sie schreiben Briefe, klopfen an Türen, interviewen Menschen aus der linken Szene von damals. Ernst-Volker Staub, Daniela Klette und Burkhard Garweg müssen noch Kontakte haben, glauben Sie, jemand muss ihnen helfen. Also fragen Sie herum bei ehemaligen RAF-Sympathisanten und Verdächtigten, aber auch bei Ermittlern von damals und heute. Die drei Räuber haben Sie nicht gefunden. Ihre Spurensuche liest sich trotzdem spannend in der ersten Hälfte des Buches.
Brauchen drei schwerbewaffnete Räuber denn Hilfe von alten Freunden, wenn sie insgesamt Millionen erbeutet haben bei ihrer Überfallserie? Können sie nicht irgendwo scheinbar legal wohnen unter falschem Namen und mit guten Perücken? Eine Wohnung oder ein Häuschen, gemietet oder sogar gekauft als die Ausweise noch leichter zu fälschen waren als heute, und alle paar Jahre ein Überfall, wenn das Geld ausgeht - warum sollten die drei noch Hilfe brauchen? Je weniger Mitwisser, desto sicherer. Wenn sie aber Hilfe haben, dann am sichersten von Menschen, die nie zusammen mit ihnen auf einer Kundgebung waren, nie zusammen mit ihnen in der Zeitung gestanden haben. In diese Richtung suchen Sie nicht, Frau Schlosser, könnten Sie auch gar nicht. Aber haben Sie daran gedacht?
Während Sie mit Ihrem Vater zusammen durch Deutschland fahren und alte Linke besuchen, streiten Sie beide sich darüber, was der Staat darf. Linksgrüner Idealismus trifft auf Rechtsstaat. Mitunter, wenn die Suche zäh wird, fragen Sie sich selbst ein oder zwei Seiten lang nach Ihren Überzeugungen. Diese Gedanken sind schlecht platziert im Buch: Wenn die Spannung sackt, muss es schnell weitergehen. Zeit zum Überlegen ist, wenn Sie uns an einer brisanten Stelle etwas zappeln lassen wollen.
Auf so einer Gedankenseite zitieren Sie einmal Yuval Noah Harari, wie er Terroristen mit einer Fliege im Porzellanladen vergleicht. Selber kann das Tierchen nichts kaputt machen, aber bei dem Versuch, es loszuwerden, schlägt man das Geschirr zu Scherben. Fragen Sie die israelische Olympiamannschaft von '72, was sie getroffen hat: eine Fliege oder Kugeln und Granaten? Fragen Sie die Toten vom Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, welche Fliege da einen Laster in die Menschenmenge steuerte.
Ab der Mitte des Buches ist klar, dass Sie nichts mehr herausfinden werden. Wir haben auch kein klares Bild von den drei Menschen bekommen, die sich bis heute vor der Polizei verstecken. Von da an trägt die Erzählung Ihres Vaters das Buch: Wie palästinensische Terroristen die israelische Olympiamannschaft als Geiseln nahmen, wie hilflos die Polizei herumfuchtelte, wie die Nacht in einer Schießerei endete. Was Sie dazwischen über die Gegenwart schreiben, hätte ich beinahe überblättert.
Gut gefallen hat mir, wie Sie den Dialekt Ihres Vaters nur gerade so viel verhochdeutschen, dass jeder Berliner Ihr Buch lesen kann. Gefallen hat mir auch, wie lebendig Sie die Interviews schildern. Einen Spinner, der angeblich die RAF kennt und in der halben Welt gekämpft hat und von allen Geheimdiensten verfolgt wird, sortieren Sie nicht etwa aus, sondern lassen uns mitlachen.
Sie untersuchen eine RAF-Generation, zu der wenig steht in Stefan Austs dickem Buch über den Baader-Meinhof-Komplex. Im Geschichtsunterricht kam diese Generation auch nur in einem Nebensatz dran - zu Recht, wie ich jetzt finde. Anscheinend sind so viele Fragen unbeantwortet, dass die Lehrer in der Schule höchstens Halbwissen verbreiten könnten. Dann besser ein Buch wie Ihres, das ohne klare Schlüsse endet.
Warum man so wenig weiß, das zeigen Sie deutlich, Frau Schlosser: Die Linke mauert, weil einerseits noch immer Genossen im Untergrund sind, und weil andererseits die meisten nicht wissen, wie sie reden sollen über die RAF-Attentate. Wahrscheinlich haben sich die Sympathisanten, aber auch die Terroristen den Terror anders vorgestellt. Die Polizisten konnte man sich zu Feinden zurechtdenken, aber niemand wird vorausgesehen haben, wie viele Passanten, Fahrer, zufällige Mit-Opfer die RAF ermorden würde. Die letzten Terrorverdächtigen sind jetzt gewöhnliche Räuber. Wer reden wollte, müsste die Menschen von den Idealen trennen. Der Kommunismus und die RAF sind beide gescheitert, aber auf unterschiedliche Weisen.
Den Schluss wollten Sie versöhnlich halten. Das gelingt Ihnen halbwegs. Rund aber liest er sich nicht.
Ich hoffe, diese ausführliche Rezension nützt Ihnen etwas für zukünftige Bücher. Ich würde mehr von Ihnen lesen.
Hochachtungsvoll
Christina Widmann de Fran
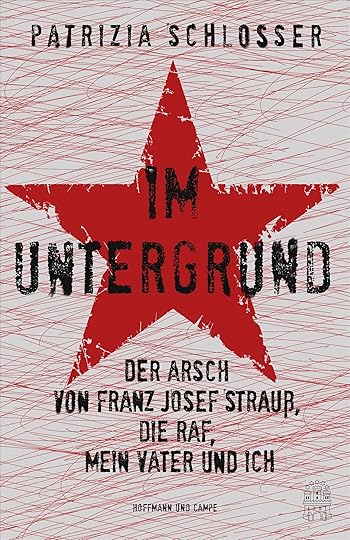
Im Untergrund: Der Arsch von Franz Josef Strauß, die RAF, mein Vater und ich von Patrizia Schlosser
erschienen im September 2019 bei Hoffmann und Campe.
Ich danke für ein Rezensionsexemplar.
ISBN: 978-3-455-00649-0
Erhältlich auf Amazon.de.



