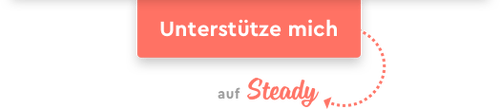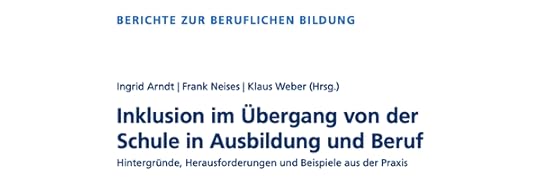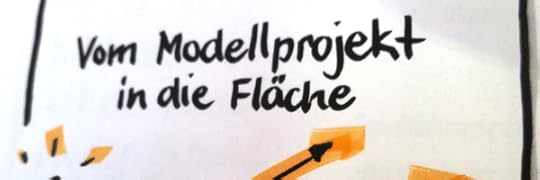Raúl Aguayo-Krauthausen's Blog, page 20
February 4, 2019
Interview zur schulischen Inklusion: “Es wird massiv gebremst – und es gibt keine Anzeichen, dass sich dies ändern könnte”
Streitthema Inklusion: Gemeinsames Lernen erfordert Ausdauer und Investitionen, sagt Raúl Aguayo-Krauthausen, Gründer des Vereins Sozialhelden – und Streiter für ein inklusives Bildungssystem. Das Engagement der meisten Bundesländer dabei sieht er allerdings kritisch. Auf der Bildungsmesse didacta geht der Autor und Moderator mit Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, in den Clinch. Der hatte ein Aussetzen der Inklusion gefordert.
January 29, 2019
Newsletter: Wie Du über Vielfalt schreibst; Gegen #Heimzwang; Verhinderte Inklusion an Schulen; Die echte #BirdBoxChallenge; Unfaire Kritik an Greta Thunberg. Vom 29. Januar 2019
Jeden Dienstag gibt es von mir kuratierte Links zu den Themen Inklusion und Innovation. Ihr könnt ihn auch als Newsletter abonnieren. Kein Spam. Versprochen! Hier gibt es die vergangenen Ausgaben.
Newsletter abonnieren
Gastkolumne
 Anne Gersdorff
Anne Gersdorff
engagiert sich für Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit. Bei BIS e.V. begleitet sie Menschen mit Behinderungen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt lernen und arbeiten. Mit dem DisAbility Talent Programm möchte sie, dass zukünftig auch Menschen mit Behinderung in Führungspositionen sitzen. Außerdem ist sie im Vorstand von Wild:LACHS für alle e.V. und als Workshop-Referentin tätig. Weil ihre Muskeln eher zu der faulen Sorte gehören, saust Anne im Rollstuhl durch die Welt und beschäftigt neun Assistent*innen, die ihr ihre Kraft leihen.



„Wie abhängig ist eigentlich unabhängig?“
Unabhängigkeit scheint eines der hohen Güter unserer Zeit zu sein. Alles und jede*r möchte von allem unabhängig sein. Doch wie ist das eigentlich, wenn ich immer von jemanden abhängig sein muss? Und dabei meine ich nicht die Abhängigkeiten in die wir alle mehr oder weniger verstrickt sind – zur Familie, zu Personen die wir lieben und zum Geld beispielsweise. Menschen mit Behinderung sind häufig in bestimmten Situationen abhängiger. Möglichst frühzeitig wird alles darauf angelegt durch bestimmte Therapien und Forderungen möglichst ohne Hilfe und Unterstützung – also unabhängig – leben zu können. Ich z.B. werde ein Leben lang von der Kraft anderer Menschen und auch Maschinen abhängig sein. Da kann ich mich noch so sehr anstrengen. ‚Nur‘ um wirklich Husten zu können, benötige ich einen sogenannten Cough Assist und eine*n eingearbeitete*n Assistent*in.
Dabei führe ich vermutlich eins der unabhängigsten Leben, die ich als Mensch mit Behinderung so führen kann. Ich lebe in einer eigenen Wohnung, die an meine Bedürfnisse angepasst ist. Ich habe Assistent*innen, die ich selbst anstelle. Somit kann ich entscheiden, mit wem ich auf Toilette gehe, ob ich erst am Nachmittag aufstehe oder ein Business-Life führe. Ich habe ein eigenes Auto, das mich unabhängig von defekten Aufzügen, Anmeldungen bei der Bahn und dem Wetter von A nach B bringt. Ich habe einen Job von dem ich gut leben kann und der mir Freude macht. Dennoch bin ich davon abhängig, dass meine Assistenz stets auf meinen Körper achtet, alle Hilfsmittel funktionieren und das Amt rechtzeitig meinen Antrag bearbeitet und die Assistenz bezahlt.
Nicht ohne Grund scheint also Unabhängigkeit, häufig auch synonym mit Selbständigkeit und Selbstbestimmung benutzt, eins der meist genutzten Slogans der Behindertenhilfe zu sein. Dabei bewirken klassische Systeme in Heimen oder Werkstätten doch eher das Gegenteil.
Um mehr Menschen mit Behinderungen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, würden mit dem BTHG die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ eingeführt. Damit kam das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einer großen Förderung der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung nach. Das ist gut und sicher eine tolle und wichtige Sache. Erstmals bekommen Vereine eine solide Finanzierung. Außerdem sollen darin insbesondere Menschen mit Behinderung beraten. Doch wie unabhängig sind diese Beratungsstellen eigentlich? Gerade in den ländlichen Regionen Deutschlands werden diese von den klassischen Wohlfahrts-Unternehmen betrieben. Der Bund stellt für die EUTBs 58 Millionen Euro jährlich bis 2022 zur Verfügung. Aber kann nicht auch sein, dass es dafür möchte, dass seine Maßnahmen, wie z.B. das Budget für Arbeit, Wirkung zeigen?
Also auch da wo „unabhängig“ draufsteht, ist Abhängigkeit drin. Vermutlich ist das immer ein Stück weit so. Doch wichtig ist diese kritisch zu hinterfragen. Denn: Inklusion wäre, wenn wir keine „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ bräuchten, weil jede*r die Unterstützung bekommt, die er*sie braucht.
Handgeplfückte Links
So viele nicht erzählte Geschichten
https://raul.de/allgemein/so-viele-nicht-erzaehlte-geschichten/
Schreiben über andere Menschen ist nicht leicht. Ich bin ja nicht du. Und wenn es leicht gerät, ist etwas faul: eine Anleitung.
Sechs Minus im Rechnen für saarländische Verwaltung
https://kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/39451
Über 100 behinderte und nichtbehinderte Menschen kamen am Donnerstag, den 24. Januar, nach Saarbrücken und demonstrierten in Eiseskälte vor dem saarländischen Landessozialamt für ein selbstbestimmtes Leben von Markus Igel mit bedarfsdeckender Assistenz. kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul sprach mit einigen der OrganisatorInnen der Demonstration über ihre Eindrücke und Schlussfolgerungen von der Demonstration und den Gesprächen mit der Verwaltung. Für Nancy Poser aus Trier ist die Sache klar: Die Juristin bescheinigt der saarländischen Behörde nicht nur mangelnde Rechtskenntnisse, sondern erteilt ihr eine glatte Sechs Minus im Rechnen.
Video: Kein #Heimzwang für Markus Igel!
https://www.facebook.com/Change.orgDeutschland/videos/652749341806792/
Empört euch – solidarisiert euch
https://kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/39418
„Empört Euch! – Schämt Euch! – Beendet das Schweigen – Solidarisiert Euch!“ Diesen Titel hat Claus Fussek aus München gewählt, um auf die massenhaften und beschämenden Menschenrechtsverletzungen im Bereich der Pflege und der sogenannten Behindertenhilfe hinzuweisen, von denen er tagtäglich hört.
Video: Gehindert an der Wahl
In Deutschland dürfen rund 85.000 Menschen mit Behinderung bei Bundestags- und Europawahlen nicht wählen. Seit Jahren verspricht ihnen die Politik, dass sich das ändert – bislang bleibt es ein Versprechen.
Gymnasien steigen in NRW aus Inklusion aus
https://www1.wdr.de/nachrichten/gymnasien-ausstieg-aus-inklusion-100.html
Gymnasien in NRW steigen weitgehend aus Inklusion aus. Gewerkschaft kritisiert Entwicklung. Schulministerium verspricht mehr Stellen.
EGMR: Autistisches Kind hat keinen Anspruch auf Regelschule
Eine Französin wollte vor Gericht durchsetzen, dass ihr autistisches Kind die Regelschule besuchen kann. Doch die Richter in Straßburg wiesen die Beschwerde als unbegründet zurück.
Inklusion: „Man kann Vielfalt nicht verordnen“
Gehören Schüler mit Behinderung ans Gymnasium? Auch wenn sie das Abitur nie schaffen werden? Zwei Schulleiter im Streitgespräch
Zugänglichkeit bei Zeitungsartikeln
https://lydiaswelt.com/2019/01/24/zugaenglichkeit-bei-zeitungsartikeln/
Lydia Zoubek schreibt über Zeitungsartikel, und wie sie für blinde Nutzer zugänglicher sein könnten.
Blinde als YouTuber und Blogger
Wenn man »Youtube für Blinde« hört, dann denkt man vielleicht erstmal an einen Scherz oder an eine Plattform, die sowas ähnliches macht wie Youtube, aber eben nicht mit Videos. Aber nein, das ist ganz wörtlich zu nehmen: Auf der größten Video-Plattform der Welt gibt es jede Menge Filme von Sehbehinderten für Sehbehinderte, aber auch für „Normalos“.
Videos: DBSV startet zwei Spots zur Diskussion um die #BirdBoxChallenge
https://www.dbsv.org/aktuell/birdboxchallenge.html
Ein Netflix-Film hat den Hype um die Bird-Box-Challenge ausgelöst. Jetzt melden sich die zu Wort, für die jeder Tag eine solche Herausforderung ist: Blinde und Sehbehinderte.
Yetnebersh: „Es ist ungerecht, wenn gehörlose Kinder nicht in Gebärdensprache lernen können“
Yetnebersh Nigussie gehört zu den drei ersten Frauen mit Behinderung, die an der äthiopischen Universität von Addis Abeba ihr Jura-Studium abgeschlossen haben. Als Rechtsanwältin und Aktivistin setzt sie sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein.
Kritik an Greta Thunberg – Die häufigsten Vorwürfe – und was von ihnen zu halten ist
Das Wirken der populären Klimaaktivistin Greta Thunberg wird von vielen Usern kritisch gesehen. Auch, weil sie Autistin ist. Was ist an den Vorwürfen dran?
Leben mit Behinderung: Jetzt, da sie älter sind
Die Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung steigt. Doch wo und wie sollen sie in Würde altern?
Video: Über angemessene Vorkehrungen und Ableismus
https://www.youtube.com/watch?v=EN80Kp3_NF4&feature=youtu.be
„Angemessene Vorkehrungen“ und „Ableismus“, das sind Begriffe, die zunehmend in der Behindertenpolitik diskutiert werden. Die Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), Dr. Sigrid Arnade, erklärte in einem Grußwort, was ihr beim Thema Angemessene Vorkehrungen und Ableismus so wichtig ist.
Mit Prothese in den Ring – Magazin Barrierefrei
https://barrierefrei-magazin.de/blog/mit-prothese-in-den-ring/
Einen Prothesenträger, der Mixed Martial Arts (gemischte Kampfkünste, kurz MMA) betreibt, sieht man selten. Jemand mit einer körperlichen Einschränkung scheint sich beim Kampfsport mit Vollkontakt dem Risiko auszusetzen, weitere Verletzungen davon zu tragen? Für viele ist das bestimmt irritierend. Diejenigen, die es ausprobieren, sind jedoch begeistert, wie Yasmin Uygun berichtet.
Behinderung: Auf Twitter teilen behinderte Menschen ihre Erfahrungen
Menschen mit einer Behinderung müssen sich tagtäglich viele dumme Sprüche anhören oder werden von der Gesellschaft in ihrem Alltag behindert. Das beweist nun auch der Hashtag #ThingsDisabledPeopleKnow auf Twitter.
Inklusive Forschung darf kein Wettbewerbsnachteil sein!
https://bodys.evh-bochum.de/kampagne-inklusive-forschung.html
Unter dieser Überschrift wurde zum Abschluss der Tagung „Unsere Teilhabe – Eure Forschung?“ an der TU Dortmund eine Kampagne zur Ergänzung von Projektbestimmungen gestartet.
Mein Handy als Auge: Fünf Apps für blinde Menschen im Test
https://ze.tt/mein-handy-als-auge-fuenf-apps-fuer-blinde-menschen-im-test/
Wie viel Verspätung hat mein Zug? Ist die Milch noch gut? Solche Alltagsfragen stellen blinde Menschen oft vor Herausforderungen. Smartphone-Apps sollen helfen. Wie gut funktioniert das?
27. Januar: Der Holocaust-Gedenktag
https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/sehen-statt-hoeren/gedenktag-holocaust-100.html
Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die sowjetischen Truppen befreit. 51 Jahre später – 1996 – wird dieses Datum vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zum bundesweiten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus auserwählt. An die 1.500 gehörlose Menschen waren unter den Opfern.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 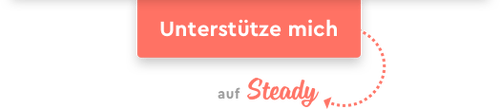
January 27, 2019
So viele nicht erzählte Geschichten
 Schreiben über andere Menschen ist nicht leicht. Ich bin ja nicht du. Und wenn es leicht gerät, ist etwas faul: eine Anleitung.
Schreiben über andere Menschen ist nicht leicht. Ich bin ja nicht du. Und wenn es leicht gerät, ist etwas faul: eine Anleitung.
Neulich stockte mir bei einem Satz der Atem. Die Schriftstellerin Nicola Griffith schrieb in der New York Times, Literatur über Behinderung sei auf dem Stand der Queer-Literatur vor 70 Jahren. Sie begründete es mit einem Test, den der Aktivist Kenny Fries entworfen hatte – und der geht so: Gibt es in einem Roman, in einer Kurzgeschichte oder einem Theaterstück mehr als einen Charakter mit Behinderung? Haben diese Charaktere einen eigenen Charakter außerhalb der Aufgabe, Nichtbehinderte zu erziehen oder sie gut dastehen zu lassen? Und wird die Behinderung dieser Charaktere nicht eliminiert, etwa durch Heilung oder Tod? Dieser Test basiert auf dem so genannten Bechdel-Test, der danach fragt, ob es in einem Werk zwei Frauen gibt, die miteinander über anderes reden als über Männer. Dieser Ursprung ist wichtig, denn er sagt viel darüber aus, was passiert, wenn Leute aus einer großen Gruppe über die einer kleinen Gruppe reden.
Nicola Griffith startete also in den Sozialen Medien eine Anfrage, man solle ihr bitte Bücher nennen, die solch einen Test bestehen. Sie kam auf eine Liste von 55 Werken, einige alt und vergriffen. Nach aus Auskunft des Stanford Literary Lab, so Griffith, existierten derzeit rund fünf Millionen Romane in der Englischen Sprache. Und rund ein Viertel der Amerikaner habe eine Behinderung. Also müssten es umgerechnet 1,25 Millionen Romane sein, welche dies thematisieren. Es sind aber 55.
Ich sehe darin eine Befangenheit. So viele Geschichten, die fehlen. Und weil sie nicht aufgeschrieben werden, erhält sich die Befangenheit, setzt sich fort.
Faszinierend finde ich die Erfahrungen, die Griffith auf dem Weg zu diesem Test gemacht hatte: Sie wuchs in einer katholischen Familie in Nordengland auf und bemerkte recht schnell, dass es zwei Narrative gab: Der eine fand den katholischen Glauben gut, der andere beschrieb ihn als schlecht. Griffith schreibt, sie habe mit fünf Jahren bemerkt, dass sie Mädchen mochte. Das fand sie normal. Erst mit neun erfuhr sie, dass es eine dominante Geschichte gab, die meinte: Das sei schlecht. Mit 15 ging sie erstmals in einen Schwulenclub, fand das Küssen der Männer ekelig und erschrak über ihre Reaktion. Also ging sie einen Monat lang in diesen Club, um die alte Geschichte zu überschreiben und zu lernen, dass küssende Männer nun keine Sensation irgendeiner Art sind. Dann erkrankte sie vor 25 Jahren an Multipler Sklerose und brauchte wiederum Jahre, um den ableistischen Narrativ zu verstehen, den sie absorbiert hatte. Sie kennen das Wort „ableistisch“ nicht? Macht nichts, auch meine Rechtschreibkorrektur will es unbedingt rot unterstreichen, es meint die Abwertung von Menschen mit Behinderung, sowas wie „behindertenfeindlich“. Denn nun fiel Griffith auf, dass in Romanen Menschen mit Behinderung entweder einen tragischen Krüppel spielten, oder einen wütenden oder einen hilflosen – geschrieben von Autoren, die keine Behinderung hatten und deren Schreibe man ansah, dass die Vorstellung, mit einer Behinderung zu leben, eine schreckliche sein müsse.
Nun, das Leben mit einer Behinderung kann hart sein, tragisch ist es nicht. Manchmal sind die gemachten Umstände um mich herum tragisch, ich persönlich ziehe indes vor, über sie zu lachen, ich meine die Umstände, nicht die Behinderung.
Daher kann ich nur dazu aufrufen: Schreibt sie, die vielen bisher stummen Geschichten! Natürlich muss man keine Behinderung haben, um darüber zu schreiben. Es ist aber ratsam, gewisse Regeln zu beachten.
Wie die aussehen könnten, hat Kayla Ancram aufgeschrieben. Die Schriftstellerin hat für Freund_innen notiert, was zu beachten sei, wenn Weiße in einem fiktionalen Werk über nicht-weiße Protagonist_innen schreiben. Und es passt meiner Meinung nach gut zu dem, was beim Schreiben über Menschen mit Behinderung anfällt, siehe große und kleine Gruppe. Ancram rät zu Forschung, Beharrlichkeit und Abwägung.
Unter Forschung meint sie, dass erst einmal vergessen werden sollte, was man über nicht-weiße Frauen denkt – denn diese Gedanken werden von Medien transportiert, in denen kaum nicht-weiße Frauen sitzen. Ancram empfiehlt also sich hinzusetzen und Literatur zu lesen, und zwar von nicht-weißen Frauen für nicht-weiße Frauen. So lasse sich herausfinden, welche Diskurse wie bei ihnen ablaufen. Auch Tumblr-Blogs von nicht-weißen Frauen empfiehlt sie, um ein Gespür für relevante Themen zu kriegen. In einem nächsten Schritt sollte man sich mit den zahlreichen Klagen nicht-weißer Frauen darüber auseinandersetzen, welche Porträts über sie in die Hose gingen – und warum. Zu beklagen gibt es viel, da fühlt man sich als weißer Leser_in rasch als Opfer, aber Ancram plädiert dafür, sich von den persönlichen Gefühlen zu lösen und einfach zuzuhören, zuzuhören, zuzuhören. Letzten Endes habe man nicht zu erleben, was diesen Kritikerinnen täglich widerfährt. Und viel Härte komme vom Ärger. Zorn sei weniger ein Vorurteil denn eine alte Wunde, Angst und Schmerz. Es geht über sie und nicht über dich.
Drauflos schreiben ist also wenig sinnvoll. Nicht, dass es Autor_innen ergeht wie dem Regisseur James Cameron in seinem angeblich so wegweisenden Film „Avatar“. Camerons Story ist furchtbar altbacken, er reaktiviert eine Pocahontas-Version. Hätte er Ancrams Ratschläge befolgt, wäre ihm ein besserer Film gelungen; Ureinwohnern Amerikas gefiel die sexualisierte Pocahontas-Version nicht, und Camerons Märchen auch nicht. Durchgefallen.
Ancram macht sich dafür stark, nun nicht farbenblind zu werden. Es sei unrealistisch, schreibt sie, wenn weiße Charaktere so tun, als wenn Nicht-Weiße nicht nicht-weiß wären. Es gilt sich dem also zu stellen. Mit Forschung, Beharrlichkeit und Abwägung.
Ob Sexualität, Geschlecht, Ethnie oder Behinderung: Am schlimmsten wird es, wenn Leute meinen Bescheid zu wissen. Aber es in der Regel nicht tun.
Einfache Regeln zum Schreiben über Menschen mit Behinderung habe ich bei der Bloggerin Larli Beth gefunden. Wenn ihr da draußen also einen Roman schreiben wollt, eine Kurzgeschichte, ein Hörspiel oder wasauchimmer, diese Regeln sind Gold wert, wenn ihr realistisch sein wollt: Da geht es zum Beispiel darum, Behinderung nicht in den Fokus eines Charakters oder einer Handlung zu stellen; so interessant ist dies nun nicht, eben Alltag. Ignoriert oder tabuisiert werden sollte sie aber auch nicht. Am Ende ruft sie dazu auf: „Find us and ask us.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 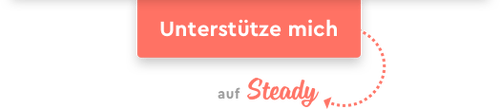
January 23, 2019
Newsletter: Untertitel, Audiodeskription & ungenaue Sprache die nicht immer helfen; Sandra Olbrich bei KRAUHAUSEN – face to face; Inklusion in der Schule & KI. Vom 22. Januar 2019
Jeden Dienstag gibt es von mir kuratierte Links zu den Themen Inklusion und Innovation. Ihr könnt ihn auch als Newsletter abonnieren. Kein Spam. Versprochen! Hier gibt es die vergangenen Ausgaben.
Newsletter abonnieren
Gastkolumne
 Wille Felix Zante
Wille Felix Zante
ist freier Autor, unter anderem für die Deutsche Gehörlosenzeitung und Leidmedien.de. Als Workshopleiter macht er Aufklärungsarbeit zum Thema Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit und Gebärdensprache. Er ist taub, schwerhörig, hörend – schwer zu sagen, und alles nicht zu hundert Prozent. Als Pronomen findet er „er“ bzw. „ihn“ ok.



„Das hat der so aber gar nicht gesagt!“
Untertitel sind eine komische Sache. Manchmal sind sie total ausführlich, beinhalten jeden Songtext im Original, manchmal fassen sie ganze Dialoge mit „Ja“ – „Nein“ – „OK“ zusammen, aber nie weiß man, was einen erwartet. Vor allem weiß ich nie, ob sie funktionieren. Deswegen bin ich so unendlich froh, wenn am Anfang vom Tatort ein „Tatort-Titelmelodie“ unten drunter steht oder eine Beschreibung der Untertitelfarben für die einzelnen Rollen. Dann weiß ich: Komme was wolle, irgendwelche Untertitel sind vorhanden und ich kann in Ruhe den Film gucken. Auch wenn die Untertitel unvorhersehbar sind.
Witziger Weise sind es oft Hörende, die sich über die Untertitel aufregen. „Der hat da aber ‚Scheiße‘ gesagt und nicht ‚Mist‘.“ Wie soll ich als gehörloser Mensch merken, ob ganze Wörter ausgelassen oder Dialekte ins Hochdeutsche umformuliert werden? Eben. Im Gespräch mit Leuten, die die Untertitel machen, stellt sich dann raus, dass es ganz genaue Richtlinien gibt, an die man sich halten müsse. Deswegen fallen Wörter weg. Aha. Ich finde das schade, weil es oft die unwichtigen Wörter sind, die so viel ausmachen. Und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Richtlinie von Hörenden erfunden wurde. Von Menschen, die keine Ahnung haben, was es heißt, sich verstärkt visuell durch die Welt zu bewegen.
Ich lehne mich mal jetzt etwas aus dem Fenster und sage: Die Untertitel sollten einfach ein möglichst genaues Abbild dessen sein, was gehört wird. Also möglichst jedes Wort untertiteln, auch wenn’s viel ist — wenn viel gesprochen wird, hört man auch nicht alles, oder? Und vor allem die Geräusche so präzise wie möglich beschreiben und die Liedtexte im Original untertiteln. Ich freu mir jedes Mal einen Keks, wenn ein französisches Lied im Original untertitelt wird, auch wenn ich es kaum verstehe.
Erst dann kann man dann das alles schlicht und inklusiv „Untertitel“ nennen. Diese ganzen Zusatzbezeichnungen wie „für Gehörlose“ oder „für Hörbehinderte“, oder – besonders schön – das nicht tot zu kriegende „Gehörgeschädigte“ können dann in die Tonne.
Handgeplfückte Links
Ungenaue Sprache hilft niemandem
https://raul.de/allgemein/ungenaue-sprache-hilft-niemandem/
Natürlich ist das keine Einladung, Menschen gegen ihren Willen irgendwie zu betiteln, sie zu diskriminieren. Aber Diskriminierung kann auch dadurch entstehen, wenn man Tatsachen schönredet. So bin ich neulich, auf eine Studie gestoßen, welche ForscherInnen an der University of Wisconsin-Madison und der University of Kansas unlängst veröffentlichten. Sie wollten wissen, inwiefern Euphemismen zielführend sind: Denn Euphemismen, also Glimpfwörter oder Beschönigungen, sollen ja effektiv sein. Ihre UrheberInnen benutzen sie, um eventuellen Beleidigungen vorzubeugen, um Gesichtsverlusten zu entgehen, um irgendwie zu helfen. Ich habe von Eltern gehört, die lieber von ihren Kindern mit „speziellen Bedürfnissen“ sprechen als „mit Behinderung“. Das Leben sei schon hart genug. Aber hilft derartiges?
Folge 18: KRAUTHAUSEN – face to face mit Sandra Olbrich
https://krauthausen.tv/gaeste-sendungen/sendung-18-mit-sandra-olbrich/
Zu Gast bei KRAUTHAUSEN – face to face: Sandra Olbrich, Journalistin und Moderatorin. Wir unterhalten uns über ihren Werdegang und die Hindernisse, die überwunden wurden.
Inklusion ist kein Luxus – Die Kinder der Utopie
https://www.diekinderderutopie.de/inklusion_ist_kein_luxus
Vor dem Gesetz und vor Gott sind alle Menschen gleich, so steht es im Grundgesetz und in der Bibel. Schöne Idee eigentlich.
Was Erik kann – Die Kinder der Utopie
https://www.diekinderderutopie.de/was_erik_kann
Schul-Inklusion – das ist eine gute Sache für viele SchülerInnen. Gerade Kinder mit Körperbehinderung passen gut in Regelklassen, wenn die Räumlichkeiten barrierefrei sind. Aber Inklusion geht natürlich nicht bei jedem Kind. Aber stimmt das auch?
In der ARD-Mediathek: „Die Story im Ersten: Das Märchen von der Inklusion“
Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in einer Schule. Jeder Mensch kann überall dabei sein, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion. Eine Idee, so schön wie ein Märchen.
Aufruf zum Voting für das Institut für Inklusive Bildung!
https://voting-socialimpact.eu/Wirkungsfonds_2019_-Institut_fuer_Inklusive_Bildung
Das Institut für Inklusive Bildung ist weltweit einmalig. Es qualifiziert Menschen mit Behinderungen, die bislang in einer Werkstatt (WfbM) arbeiten, zu Bildungsfachkräften. Als Bildungsfachkräfte sind sie fest auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt am Institut angestellt und arbeiten hauptberuflich in der Hochschulwelt. Sie leisten Bildungsarbeit an Fachhochschulen und Universitäten und vermitteln Studierenden sowie Lehr-, Fach- und Führungskräften die Lebenswelten, spezifischen Bedarfe und Kompetenzen von Menschen mit Behinderungen aus erster Hand. Dadurch erreichen sie einen enormen Multiplikationseffekt für Inklusion! Das Institut für Inklusive Bildung ist eine wissenschaftliche Einrichtung, angegliedert an die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Dadurch sind Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen Teil der wissenschaftlichen Welt.
Die Bewerbungsfrist für den Jakob Muth-Preis 2019 läuft!
https://www.jakobmuthpreis.de/bewerbung/publikumspreis-fuer-inklusive-schuelerinnenprojekte/
10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention und 10 Jahre Jakob Muth-Preis. Bewerben können sich Einzelschulen, Verbünde und, zum ersten Mal, inklusive SchülerInnenprojekte. Habt Ihr selber ein inklusives Schüler*innenprojekt auf die Beine gestellt oder wisst davon? Dann schnell bewerben! Alle Infos zu Kriterien und Bewerbung finden sich auf der Website.
PDF: Learning by doing – Inklusion entwickelt sich
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/9556
Ein BIBB-Sammelband zu „Inklusion im Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf“ bündelt erfolgreiche Praxisbeispiele, Expertenbeiträge und Ausschnitte des Fach- und Praxiswissens für gelingende Inklusion.
Bewerbungen ab sofort auch in Berlin möglich: Das DisAbility Talent Programm
https://www.disability-talent.com/news/20181-erfahrungsbericht-disability-talent-programm
Evgenia G., ein DisAbility Talent, hat ihre Erfahrungen exklusiv für uns zusammengefasst. Erfahre aus erster Hand, wie dich das DisAbility Talent Programm beim Karrierestart unterstützt.
Martin Habacher dreht nicht mehr – er fehlt mir jetzt schon!
https://www.bizeps.or.at/martin-habacher-dreht-nicht-mehr-er-fehlt-mir-jetzt-schon/
Auf YouTube fühlte sich Martin Habacher in seinem Element. Wöchentlich präsentierte er seinem immer größer werdenden Publikum zumindest einen Clip. Immer mit Herzblut und Leidenschaft. Am 20. Januar 2019 verstarb er überraschend.
Abgefahren: Rollstuhlfahrer wird der Einstieg in ICE am frühen Morgen verweigert
Dem Sprecherratsvorsitzenden des Deutschen Behindertenrates (DBR) und Vorstandsmitglied der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL) Horst Frehe wurde vorherige Woche der Einstieg in einen ICE in Bremen verweigert. Er wollte einen wichtigen politischen frühen Termin am Donnerstagvormittag in Berlin wahrnehmen. Hierzu bot sich der einzige an diesem Tag durchgehende ICE von Bremen nach Berlin an, der Bremen um 5:15 verließ. Leider lehnte die Deutsche Bahn dem rollstuhlfahrenden Fahrgast die Einstiegshilfe am Hauptbahnhof in Bremen ab.
Video: Sozialbehörde zahlt zu wenig: Markus Igel bangt um selbstbestimmtes Leben
Markus Igel aus Bad Kreuznach ist seit seiner Kindheit spastisch gelähmt. Vor vier Jahren zog er in eine eigene Wohnung, wo er von Pflegern rund um die Uhr betreut wird. Doch das Landesamt für Soziales in Saarbrücken zahlt nicht genug, um seine Lebenssituation aufrecht zu erhalten.
Kritik am Stand der Inklusion „Das finde ich inakzeptabel“
https://www.tagesschau.de/inland/un-behindertenkonvention-interview-101.html
„Eine Demokratie ist nur gut, wenn sie inklusiv ist“, meint der Behindertenbeauftragte Dusel im tagesschau.de-Interview. Dass viele nach zehn Jahren UN-Behindertenrechtskonvention nicht wählen dürfen, passt da nicht.
MG KITCHEN TV – Inklusion in der Küche
Seit sieben Jahren laden Luisa und André Musiker aus aller Welt in ihre Küche nach Mönchengladbach zum ROCKEN KOCHEN ABWASCHEN ein.
Gemeinsam mit ihrem Freund Dave, der für den Sound in der Küche zuständig ist, laden sie einmal im Monat eine MG KITCHEN TV Folge auf dem gleichnamigen YouTube Kanal hoch. Die Musiker spielen zwei eigene Songs, dann wird gemeinsam gekocht. Dabei wird ein Interview geführt. Anschließend, na klar, folgt der Abwasch. Seit Dezember 2018 sieht man ein neues Gesicht bei MG KITCHEN TV. Die Interviews führt nun Steffi. Eine junge Frau mit einer geistigen Einschränkung.
Alternativen zur AudioDeskription
http://www.oliveira-online.net/wordpress/2019/01/17/alternativen-zur-audiodeskription/
So richtig überzeugt hat Domingos de Oliveira die AudioDeskription (AD) – die Filmbeschreibung für Blinde aus dem Off – bisher nicht. Für ihn ist es, als ob jemand einen Witz erzählt und im gleichen Atemzug die Pointe erklärt. Durch eine kleine Diskussion auf Facebook ist er zu diesem Beitrag angeregt worden.
Warum erkennen KI-Systeme Menschen mit Behinderungen so schlecht?
Künstliche Intelligenzen behandeln nicht immer alle Menschen gleich. Besonders schwer tun sie sich damit, Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. IBM-Forscherin Shari Trewin will das ändern.
Living with Muscular Dystrophy and fighting against animal experimentation
https://criphumanimal.org/2019/01/17/interview-johnathon-byrne/
Johnathon Byrne is an animal rights activist from the UK. He is a student in Animal Science and Welfare and has volunteered in wildlife conservation projects in South Africa. Johnathon has Muscular Dystrophy (MD) and actively campaigns against the use of animals in medical research.
Is it ever OK for non-disabled actors to play disabled roles?
Bryan Cranston’s defence of playing a wheelchair user only strengthens a cycle that shuts out disabled actors.
Microsoft Soundscape – A Map Delivered in 3D Sound
https://www.closingthegap.com/microsoft-soundscape-a-map-delivered-in-3d-sound/
Microsoft Soundscape is a research project that explores the use of innovative audio-based technology to enable people, particularly those with blindness or low vision, to build a richer awareness of their surroundings, thus becoming more confident and empowered to get around. Unlike step-by-step navigation apps, Soundscape uses 3D audio cues to enrich ambient awareness and provide a new way to relate to the environment. It allows you to build a mental map and make personal route choices while being more comfortable within unfamiliar spaces.
Functional skills of those with Down syndrome can improve into adulthood
A new study from MassGeneral Hospital for Children looks at how people with Down syndrome continue to learn.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 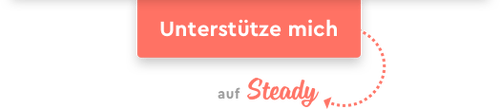
Interview für „Die Story“ im Ersten: „Das Märchen von der Inklusion – Eine Bilanz nach 10 Jahren“ vom 21. Januar 2019

Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in einer Schule. Jeder Mensch kann überall dabei sein, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion. Eine Idee, so schön wie ein Märchen.
KRAUTHAUSEN – face to face: Sandra Olbrich, Journalistin und Moderatorin
In der Sendung „KRAUTHAUSEN – face to face“ lade ich als Moderator Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende und Medienleute mit und ohne Behinderung zum Talk ein. In “face to face”-Gesprächen tausche ich mich mit einem jeweiligen Gast über künstlerisches Schaffen, persönliche Interessen und Lebenseinstellungen aus. Und natürlich geht es auch ab und zu um das Thema Inklusion.
Als achtzehnten Gast hatte ich die Moderatorin und Journalistin Sandra Olbrich zu besuch
Zum Video mit Gebärdensprache hier entlang auch Verfügbar mit Audiodeskription (AD).
Zu Gast bei KRAUTHAUSEN – face to face: Sandra Olbrich, Journalistin und Moderatorin. Mit Raul Krauthausen unterhält sie sich über seinen Werdegang und die Hindernisse, die überwunden wurden.
Mehr Infos:
facebook.com/sandra.klattolbrich
Erstausstrahlung: 19.01.2019, 9.30 Uhr, Sport 1
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 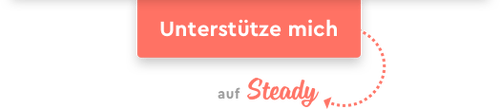
January 18, 2019
Ungenaue Sprache hilft niemandem

Wir leiden an einer besonderen Krankheit, und zwar an der Euphemismus-Falle. Die einzige Heilungsmöglichkeit: Sagen, was ist.
Zugegeben, der Leitspruch „Sagen, was ist“ vom ehemaligen Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein scheint ganz offensichtlich aus der Mode zu sein, seit der dort angestellte Reporter Claas Relotius aufschrieb, was nicht war, sondern vielmehr in seinem Kopf entstand.
Ich finde den Leitspruch nach wie vor gut. Werden die Dinge nicht genau benannt, entstehen Probleme. Unscharfe Formulierungen bergen Missverständnisse, lassen Paare sich entzweien und sogar Staaten in Kriegszustand fallen. Nicht sagen, was ist, zieht meist Unheil an.
Die Beschönigung bildet eine eigenartige Unterkategorie der ungenauen Sprache. Ich selbst habe es zum Beispiel immer komisch gefunden, wenn andere meine Behinderung als „Handicap“, „Herausforderung“ oder „anders befähigt“ bezeichnen oder mich als Menschen mit „speziellen Bedürfnissen“ beschreiben. Nun, ich glaube zwar schon, dass ich speziell bin. Das nehme ich aber von den Nachbar_innen auch an – bei dem grausigen Musikgeschmack! Und die darüber sind auch nicht ohne – bei den fragwürdigen Küchengerüchen! Allerdings sind meine Bedürfnisse nicht speziell (sprich extravagant), denn ich will mich als Mensch im Rollstuhl einfach ebenso fortbewegen können wie ein/e Fußgänger_in. Und ein Kind mit einer Lernbehinderung hat genauso wie ein Kind ohne Behinderung das Bedürfnis nach Bildung – sie für beide passend bereitzustellen ist notwendig, gerade weil sich die Wege unterscheiden.
Jeder Mensch hat etwas Spezielles an sich: Diese Aussage ist wiederum so allgemein, dass sie nichtssagend ist. Und sie lenkt ab; ich habe eine Behinderung, das ist zwar eine Herausforderung, aber nicht nur und nicht immer. Sie ist auch kein Handicap, denn ich spiele weder Golf noch dauert meine Behinderung nur ein, zwei Wochen. Auch sehe ich durchaus Befähigungen bei mir, aber nicht unbedingt gespiegelt durch meine Behinderung. Die Wahrheit, dass ich Glasknochen habe, mag hart sein, wird durch eine besondere Umschreibung aber nicht unwahrer. Ich lebe mit ihr, und das zu beschnönigen hilft keinen Deut.
Ich kenne übrigens gar keine anderen Menschen mit Behinderung, die sich wünschen, mit den obigen Attributen bedacht zu werden. Es ist seltsam, dass Menschen ohne Behinderung uns erzählen, wie wir Menschen mit Behinderung zu benennen sind. Eigentlich sollten sie auf uns hören, nicht umgekehrt.
Euphemismen schaden
Natürlich ist das keine Einladung, Menschen gegen ihren Willen irgendwie zu betiteln, sie zu diskriminieren. Aber Diskriminierung kann auch dadurch entstehen, wenn man Tatsachen schönredet. So bin ich neulich, auf eine Studie gestoßen, welche Forscher_innen an der University of Wisconsin-Madison und der University of Kansas unlängst veröffentlichten. Sie wollten wissen, inwiefern Euphemismen zielführend sind: Denn Euphemismen, also Glimpfwörter oder Beschönigungen, sollen ja effektiv sein. Ihre Urheber_innen benutzen sie, um eventuellen Beleidigungen vorzubeugen, um Gesichtsverlusten zu entgehen, um irgendwie zu helfen. Ich habe von Eltern gehört, die lieber von ihren Kindern mit „speziellen Bedürfnissen“ sprechen als „mit Behinderung“. Das Leben sei schon hart genug. Aber hilft derartiges?
Die Studie verneint diese Frage. Um die Effektivität des Euphemismus „special needs“ zu untersuchen, haben die Forscher_innen sogenannte Vignetten entwickelt. Also Kurzgeschichten über hypothetische Charaktere, die 530 erwachsenen Proband_innen vorgestellt wurden, welche dann Entscheidungen treffen mussten. Es ging um Situationen wie: In einem Studierendenwohnheim wird ein_e Mitbewohner_in gesucht, für die Schulklasse ein_e zusätzlich_e Schüler_in oder für ein Arbeitsprojekt ein_e Kollege_in. Die zur Auswahl stehenden vier „Kandidat_innen“ wurden biografisch beschrieben, die erste Person wurde mit „special needs“ versehen, die andere mit „disability“ (Behinderung), bei der dritten wurde die Art der Behinderung konkret benannt (blind, taub etc.) und bei der vierten wurde nichts über eine Behinderung erwähnt. Die Proband_innen sollten daraus ein Ranking erstellen. Welche Person stand mit Abstand am häufigsten an letzter Stelle? Eben jene mit den „special needs“! An erster Stelle wurden natürlich die „no label“-Leute gewählt, dann die vagen „has a disability“ und zumeist an dritter Stelle gelangten die mit der „certain disability“. Die wissenschaftliche Erkenntnis lautet also, dass die Beschönigung nicht funktioniert, sie bringt dem Adressierten keinen Erfolg. Es kommt noch schlimmer. Wer verschönert, so die Studie, dramatisiert nicht nur die wahrgenommene Negativität, sondern auch die wahrgenommene Negativität des verschönernden Wortes selbst. Eindrücklich illustrieren dies die Forscher_innen an den „speziellen Bedürfnissen“: Dieser Begriff ist so unspezifisch, Fluggesellschaften benutzen ihn gleichermaßen für Passagiere, die schwanger sind oder eine Erdnussallergie haben! Und alles, was speziell gemacht wird, wird potentiell segregiert. Da wird ein Fall referiert, wie ein Familienvater in einem Restaurant umgesetzt werden wollte, weil nebenan ein fremdes Kind mit einer offensichtlichen Behinderung saß. Seine Begründung: Menschen mit speziellen Bedürfnissen gehörten an spezielle Orte. Oder die Gerichtsklage einer Frau gegen ihre Nachbarin, weil in deren Garten der behinderte Enkel angeblich zu laut spielte. Inklusive Lamento darüber, dass Menschen mit einem „special needs child“ glaubten, zu einer speziellen Behandlung berechtigt zu sein. Das Spektrum der Probleme ist breit.
Dieses Vorgehen kommt mir bekannt vor. Plötzlich ist das Spielen im Garten etwas Besonderes. Oder die Rechte von Schwulen gelten als besonders. Und was bilden sich Frauen ein, gleichen Lohn beziehen zu wollen? Rechte aber sind universell. (Danke, Zivilisation!) Trotzdem wird einem ständig gesagt, was man ist und wie man sich zu fühlen hat. Frauen kennen dieses Phänomen vor allem als „Man-Splaining“ und Schwarze beim „White-Splaining“, währenddessen ihnen vorgegaukelt wird, man wisse identitätsbedingt mehr als sie. Wie wär’s damit… Lassen wir das einfach! Was Menschen mit Behinderung brauchen, ist kein Verschönern, sondern Entgegenkommen und Verständnis. Sagen, was ist!
Doch viele halten fest an einem ungesunden Umgang miteinander, obwohl sie ahnen, dass das, was als besonders oder außerordentlich deklariert wird, an den Rand gerät: Dies zeigt sich im Bildungsbereich besonders schwerwiegend. Denn, seien wir ehrlich, historisch betrachtet, ist die Öffnung des Bildungsbereichs für Menschen mit Behinderung jüngeren Datums. Segregation entspricht dagegen einer Tradition, und wer dies ändert, begeht eine systemische Infragestellung. Traditionell gehen Kinder mit Behinderung also in eine Schule, die früher „Sonder“-Schule hieß (womit wir wieder bei den besonderen Bedürfnissen sind), und nun etwas netter unter „Förderschule“ firmiert. Das ist komisch, denn die weltweite Forschung hat ergeben, dass Kinder in einem inklusiven Umfeld zu besseren akademischen und sozialen Ergebnissen kommen, also besser für das Erwachsenenleben gewappnet werden.
Oft wird dann der Elternwunsch angeführt. Doch der, so hat die Bloggerin Catia Malaquias ausgeführt, entscheidet auf Grundlage magerer Möglichkeiten: Es geht nicht um die Wahl zwischen staatlicher oder privater Schule, oder zwischen evangelischer oder katholischer Schule, sondern zwischen einer segregierenden Schule mit garantiert verringerten Bildungschancen und einer Regelschule, die meist daran scheitert, Kindern mit Behinderung entsprechend entgegenzukommen.
Man kann mit der Zeit nicht anders, als zu dem Schluss kommen: Das altbekannte Umfeld auch nur geringfügig anzupassen kostet viele immer noch mehr Überwindung, als die Etikette des „Speziellen“ hervorzuholen und zeitgleich eine ungenaue Sprache hochzuhalten. Leider hat diese Methode enormen Erfolg. Wie die Studie der University of Wisconsin-Madison offenbart, erfährt die Formulierung „special needs“ einen historischen Boom. Die „NGram“-Suche von Google erfasst seit dem Jahr 1900 veröffentlichte Bücher. Seit 1960, so verzeichnet es die Suchmaschine, tauchen die „special needs“-Schriften derart plötzlich und verbreitet auf, dass der Graph im Diagramm fast senkrecht nach oben steigt. Google Scholar vermerkt aktuell über eine Million wissenschaftliche Artikel mit dem Begriff „special needs“ und Amazon hat in der jüngsten Vergangenheit fast 5000 Bücher verkauft, welche „special needs“ im Titel tragen. Gesund, soviel kann ich sagen, ist all das nicht.
Dieser Artikel ist unter der Kolumne „Krauthausen konsequent“ auf sagwas.net zuerst erschienen.
January 16, 2019
Newsletter: Wahrheit oder Einschaltquote?; Bildungsgerechtigkeit; Demo gegen #Heimzwang; Behinderte in Film und TV; Blindes Vertrauen; Mutter & geistig behindert. Vom 15. Januar 2019
Jeden Dienstag gibt es von mir kuratierte Links zu den Themen Inklusion und Innovation. Ihr könnt ihn auch als Newsletter abonnieren. Kein Spam. Versprochen! Hier gibt es die vergangenen Ausgaben.
Newsletter abonnieren
Gastkolumne
 Lydia Zoubek
Lydia Zoubek
wurde als Kind arabischer Eltern in Jordanien geboren. Im Alter von vier Jahren kam sie nach Deutschland, besuchte die Schule und machte das Abitur.
Auf ihrem Blog schreibt sie über den praktischen Alltag als blinde Frau. Theoretische Inhalte werden nebenbei vermittelt.



Wahrheit oder Einschaltquote?
Ich stehe in Frankfurt und warte auf meine S-Bahn, als mein Handy klingelt. Am anderen Ende der Leitung eine Journalistin, die gern einen Beitrag zum Thema Blindheit machen möchte. Mit genauen Vorstellungen vom Ablauf. Sie möchte mich besuchen und einen Tag lang mit verbundenen Augen begleiten. Vorher solle ich sie noch in den Gebrauch des Blindenstocks einweisen. Und wir müssten bereits übermorgen drehen, da sie zeitliche Vorgaben bezüglich der Fertigstellung ihres Beitrags habe.
Ich bin einen Moment lang sprachlos, und fühle mich an ein paar Videos dieser Art auf YouTube erinnert. Und so erkläre ich meiner Gesprächspartnerin, dass ich für solche auf Sensation ausgelegten Beiträge nicht zur Verfügung stehe, aber gern dabei bin, wenn es um Beiträge geht, die der Aufklärung dienen.<
Stille. Dann fängt es am anderen Ende der Leitung an zu stottern. Anschließend folgen die Rechtfertigung und die Erklärung, dass es doch nur ein Selbstversuch sei. Ich gebe der Dame noch ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg, und beende das Telefonat.
Ich habe immer wieder gern Interviews gegeben, Gastbeiträge geschrieben oder andere öffentlichkeitswirksame Aktionen unterstützt. Einmal wurde ich eine Woche lang durch einen Journalisten begleitet. Alles kein Ding. Aber solche Dinge wie sensationshungrigen Fernsehtourismus unterstütze ich nicht. Das hat mehrere Gründe. Einmal erinnert es mich an ein Tier im Zoo, dass für viel Geld zur Schau gestellt wird. Es gibt ein YouTube-Video, in dem zwei Leute mit verbundenen Augen durch einen Supermarkt gehen, irgendwas aus den Regalen nehmen und sich zuhause ansehen was sie da gekauft haben. Denn Blinde sehen schließlich nicht was sie einkaufen. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die Kernaussage eines solchen Beitrags lautet: Für einen Tag blind, so hilflos habe ich mich gefühlt. Oder, ein Tag in völliger Dunkelheit, gut dass ich wieder sehen kann.
Es reicht nicht aus einem blinden Menschen einen Blindenlangstock in die Hand zu drücken und zu sagen: So, jetzt mach mal. Das braucht lange Übung, um sich damit zuverlässig orientieren zu können. So eine Übung für jemanden der sieht möchte ich also lieber nicht blind im Straßenverkehr begleiten. Jedenfalls nicht ohne kundige Assistenz. Ich würde einem Eintagsblinden auch ganz sicher nicht mein scharfes Küchenmesser in die Hand drücken und ihn zum Schnibbeln von Gemüse auffordern, geschweige denn an meinen Herd lassen.
Ich habe immer wieder Projekte an Schulen begleitet, wo Menschen mit Behinderung entsprechende Übungen mit Schülern gemacht haben. Dies geschieht im abgesicherten Raum, und ist bei guter vor- und Nachbereitung eine sinnvolle Sache mit nachhaltiger Wirkung.
Was Fernsehsendungen angeht, so schaue ich mir die Leute, denen ich etwas erkläre, etwas genauer an. Ich möchte wissen was sie oder er mit dem jeweiligen Beitrag bezwecken wollen.
Ich erinnere mich an ein Team eines privaten Fernsehesenders, die mit blinden Eltern drehen wollten. Ich war damals noch unerfahren. Daher habe ich nicht gleich kapiert, dass die beiden Mitarbeiter bereits genauere Vorstellungen hatten, und wir quasi die Schauspieler für einen vordefinierten Beitrag waren. Vielleicht braucht es solche Erfahrungen, um daraus zu lernen.
ICH möchte diesen Kommentar mit einem positiven Ergebnis abschließen. Vor ein paar Monaten schrieb mich ein Journalist an, der mich auf einem Stadtspaziergang durch meine Heimatstadt begleiten wollte. Sein Thema waren Barrieren für blinde Fußgänger im Straßenverkehr. Ich nahm mir viel Zeit für ihn, er stellte ganz viele Fragen und schickte mir unaufgefordert einen Link zum Artikel, der echt gut war. Erlebnisse wie dieses motivieren mich dazu an Aktionen teilzunehmen, die die Situation behinderter Menschen realistisch darstellen.
Handgeplfückte Links
Bildungsgerechtigkeit für Kinder mit Behinderung
https://www.diekinderderutopie.de/bildungsgerechtigkeit_fuer_kinder_mit_behinderung
Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung deckt auf, dass Bildungs-Chancen für behinderte SchülerInnen maßgeblich vom Wohnort und der Art der Behinderung abhängen.
Projektstart: TravelAble, eine App für Reisende mit Behinderung
https://news.wheelmap.org/projektstart-travelable-eine-app-fuer-reisende-mit-behinderung/
Mit TravelAble bauen die SOZIALHELDEN an einer neuen Mapping- App im Bereich Tourismus. Damit Reisen für Menschen mit Behinderung einfacher wird.
Aufruf: 24. Januar in Saarbrücken: Demo gegen #Heimzwang und gegen Lohnndumping in der Assistenz
https://www.facebook.com/events/808256759507090/
Wir von AbilityWatch fordern das Landesamt für Soziales Saarland auf, endlich Markus Igel die ihm zustehende Persönliche Assistenz zu bewilligen! Kommt zu unserer Solidaritätsdemo und unterstützt Markus Igel in seinem Kampf und verhindert, dass die menschenunwürdige Praktik Alltag in deutschen Behörden wird.
Neu im GRIPS-Theater Berlin: Cheer Out Loud! – Ein inklusives Ensemble
http://www.grips-theater.de/programm/spielplan/produktion/218
Für Regisseur Robert Neumann war es selbstverständlich, dass das Stück „Cheer Out Loud!“ nur mit einem inklusiven Ensemble funktionieren kann. Ebenso, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung nicht zwingend nur Figuren mit Behinderung spielen. Schließlich sind sie Profis: Rachel Rosen und Max Edgar Freitag kommen vom Theater Thikwa, Carina Kühne ist u.a. durch ihre Filmrolle in „Be my Baby“ bekannt geworden. Gemeinsam mit sechs Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem GRIPS-Ensemble in der Regie von Robert Neumann haben sie – auf Basis der Textvorlage von Susanne Lipp – das Stück entwickelt. Und im konkreten Tun die Möglichkeiten von Inklusion für die Theaterarbeit erforscht. CHEER OUT LOUD! – die große Spielzeitproduktion 18/19!
21. Januar, „Die Story“ im Ersten: Das Märchen von der Inklusion – Eine Bilanz nach 10 Jahren
Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in einer Schule. Jeder Mensch kann überall dabei sein, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion. Eine Idee, so schön wie ein Märchen.
Materialbox Inklusion
https://bagfa-inklusion.de/materialbox-inklusion/
Ergänzendes Angebot zum bagfa-Praxisleitfaden „Teilhabe möglich machen. Freiwilligenagenturen und Inklusion“. Sie enthält Arbeitsmaterialien, Handreichungen, vertiefende Informationen und gute Beispiele aus der Praxis zu den Themen Inklusion, Behinderung, Barrierefreiheit und inklusives Engagement.
Video: Bühne frei!
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=78082
Menschen mit Behinderung sind in Film und Fernsehen zu wenig sichtbar. Das zu verändern ist das Ziel der Berliner Agentur Rollenfang, die Schauspieler mit Beeinträchtigung vermittelt.
Systementwicklung Inklusion (M.A.)
https://www.eh-darmstadt.de/studiengaenge/systementwicklung-inklusion-ma/
Akademische Weiterbildung verbindet Inklusion und Organisationsentwicklung.
Vor diesem Hintergrund startete an der Evangelischen Hochschule Darmstadt im Wintersemester 2014/15 ein von der Max-Träger-Stiftung geförderter, innovativer, berufsbegleitender Studiengang mit dem Schwerpunkt inklusive Entwicklung von Organisationen.
Blind mit Kind: Bällebad und vollstes Vertrauen
Laute Spielplätze können für blinde Eltern eine Herausforderung sein. Doch Vertrauen hilft – und Vorsicht vor tiefhängenden Balken.
Wenn man seine Kinder nicht aufziehen darf Mutter – und geistig behindert
Viermal hat sie gespürt, wie Leben in ihr wächst. Hat sechs Kinder zur Welt gebracht. Geistig behinderte Frauen wie Melanie Werner haben ein Recht darauf, Kinder zu bekommen. Aber nur geringe Chancen, sie großziehen zu dürfen.
Leben mit Down-Syndrom
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/entwicklung-kinder-down-syndrom-1.4275457
Immer wieder stehen werdende Mütter vor dieser Situation: Der Bauch noch flach, die Kindsbewegungen noch gar nicht zu spüren, und doch müssen sie sich fragen, wie es denn nun weitergeht. Jetzt, da sie wissen, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat. Mit den immer billigeren und womöglich bald von der Kasse bezahlten Bluttests erhalten Eltern heute schon frühzeitig eine zuverlässige Diagnose der auch Trisomie 21 genannten Chromosomenstörung. Weit weniger zuverlässig sind Vorhersagen dazu, was das Testergebnis denn konkret und praktisch bedeutet. Wie groß sind die Chancen, dass sich das Kind einmal allein sein Essen zubereitet, eine Geburtstagskarte schreibt, dass es sich später glücklich verliebt?
Ausflug in Geschichte der Independent Living Bewegung
https://www.youtube.com/channel/UCU_au70OLUXOVAR-HS6rKhg/videos?sort=da&view=0&flow=grid
Wenn es um die Geschichte der Selbstbestimmt Leben Bewegung behinderter Menschen geht, dürfen die Entwicklungen in den USA nicht fehlen. Bereits in den 70er Jahren haben die AktivistInnen der Independent Living Bewegung dort erfolgreich für Antidiskriminierungsgesetze gekämpft, Peer Counseling Angebote aufgebaut und Centers for Independent Living gegründet. Für Uwe Frevert vom Verein Selbstbestimmt Leben in Nordhessen (SliN) immer wieder ein Grund, den Film „Aufstand der Betreuten“ mit Dr. Adolf Ratzka bei Schulungen zu zeigen. Nun hat Uwe Frevert den Film aus dem Jahr 1988 in kleine Teile untergliedert und mit Untertiteln auf YouTube eingestellt und lädt zu einem Ausflug in die frühen Jahre der Behindertenbewegung der USA ein.
Bei Mozilla: „Führungskräfte haben Diversity-bezogene Jahresziele“
Katharina Borchert hat sich in deutschen Verlagen, unter anderem als Chefredakteurin bei Spiegel Online, mit Diversität beschäftigt. Inzwischen ist sie Chief Innovation Officer bei Mozilla im Silicon Valley. Ihre Erkenntnisse und konkrete Maßnahmen für Diversität und Inklusion verrät sie im Interview.
10 Gründe Menschen mit Behinderung zu beschäftigen
https://www.aktion-mensch.de/10gruende
Die Wirtschaft brummt. Bestimmt spüren auch Sie den Fachkräftemangel. Sie finden keine Auszubildenden? Ihnen fehlen Mitarbeiter? Dann denken Sie doch einmal über die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung nach!
Model with Down’s Syndrome becomes brand ambassador for Benefit cosmetics
Kate Grant, who has Down’s Syndrome, is quite the esteemed model. The 20-year-old from Co Tyrone, Northern Ireland, was crowned champion in the Teen Ultimate Beauty Of The World pageant, modelled on the catwalk at Belfast Fashion Week, and also appeared on ITV show This Morning.
Film Festival introduces new film ratings system to highlight Disabled people’s contributions
A new ratings system, the D system, has been introduced by the Together! Disability Film Festival to highlight the contribution that Disabled people make in front of and behind the camera, and their widespread absence from the film world.
Smart cities could be lousy to live in if you have a disability
https://www.technologyreview.com/s/612712/smart-cities-coule-be-lousy-if-you-have-a-disability/
Cities sometimes fail to make sure the technologies they adopt are accessible to everyone. Activists and startups are working to change that.
Control Alt Achieve: Chrome Extensions for Struggling Students and Special Needs
https://www.controlaltachieve.com/2016/10/special-needs-extensions.html
Technology can be a powerful tool to assist students with special needs or any sort of learning challenge. In particular the Chrome web browser allows users to install a wide variety of web extensions that provide tools that can help all learners, regardless of ability level.
Assistive technology for visually impaired people
Vital Tech tells you all you need to know about high- and low-tech devices that make life easier for blind and partially sighted people.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 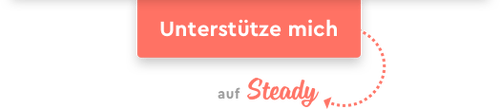
January 9, 2019
Newsletter: Constantin Groschs Kolumne; Die Gefahr des Crowdfundings; Inklusion in in der Schule und in der Kultur; Duisburger Behindertenwerkstatt zahlt mies. Vom 8. Januar 2019
Jeden Dienstag gibt es von mir kuratierte Links zu den Themen Inklusion und Innovation. Ihr könnt ihn auch als Newsletter abonnieren. Kein Spam. Versprochen! Hier gibt es die vergangenen Ausgaben.
Newsletter abonnieren

Constantin Grosch
ist Student der Soziologie an der Universität Bielefeld, als Kommunalpolitiker in seiner Heimatstadt Hameln tätig und nennt sich selbst Inklusions-Aktivist. Sein Inklusions-Podcast wurde hier schon des Öfteren vorgestellt. Das medizinische Modell von Behinderung sagt, dass er Rollstuhlfahrer sei. Das soziale Modell von Behinderung gibt wiederum an, er sei Mitglied der SPD.




Projektförderung reicht, oder?
„An manchen Tagen kann man den Eindruck gewinnen, als hätte die Politik keine Lust mehr auf Politik. Wer will es ihr verdenken?
Aber natürlich ist das Quatsch. Der Wille ist zwar da, sie hat es aber verlernt. Früher wurden noch Gesetze verabschiedet oder gar ganze Reformen. Heute dominiert ein anderes Werkzeug: die Projektförderung.
Sie ist deshalb so beliebt, weil sie so unverbindlich ist. Die Politik kann ein Ziel formulieren, ohne eine eigene Idee zur Umsetzung zu benötigen. Dann erhält sie aus der Zivilgesellschaft die tollsten Vorschläge und kann nach Gutsherrenart entscheiden, ob und was davon mal ausprobiert wird. Gibt es Kritik an der Umsetzung, kann man sich auf den Standpunkt zurückziehen, es ja nur mal modellhaft erprobt zu haben und wenn es gut läuft, kann man die Verantwortung für die flächendeckende Umsetzung ja dahin zurückgeben, wo die Idee herkam: an die Zivilgesellschaft.
Besonders beliebt ist diese Methode beim Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Seit Jahrzehnten mahnen Menschen mit Behinderungen an, Barrierefreiheit endlich zum Standard zu erheben, und zwar nicht in Sonntagsreden, sondern durch die harte Hand des Gesetzes. Wie wichtig Barrierefreiheit ist, muss im Jahr 2019 niemandem mehr erklärt werden und trotzdem ist alles, was der Politik einfällt: Projektförderung.
Ein Beispiel hierfür ist Schleswig-Holstein: „Das Land stellt in den kommenden vier Jahren [2018-2022] zehn Millionen Euro in einem Fonds für Barrierefreiheit bereit. Damit sollen Modellprojekte gefördert werden, mit denen Gebäude behindertengerecht umgerüstet und Menschen mit Behinderungen die gleiche Teilhabe am öffentlichen Leben gesichert werden soll.“
Ist das noch zu fassen? Im Jahr 2018 braucht die Politik Modellprojekte, die ihr mal beispielhaft zeigen sollen, wie das mit der ominösen Barrierefreiheit klappen könnte. Nein liebe Politik, Euer Job ist ein anderer. Euer Job ist das Aufstellen von gesellschaftlichen Regeln in Form von Gesetzen. Ich hätte da auch eine Idee, wie ihr wieder ins Training kommt: Schreibt einfach mal ein Gesetz zur Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit. Das wäre effizient, ein Fortschritt und vielleicht bekommen wir alle dann wieder mehr Lust auf Politik.“
Immer öfter erreichen mich Spendenanfragen via Crowdfunding für Assistenzhunde, Rollstühle oder barrierefreie Autos und seit Neuestem auch Assistenz. Der Staat oder die Krankenversicherungen weigern sich zu zahlen. Sind das gute Zeichen an der Wand?
Das gelbe U-Heft
https://www.diekinderderutopie.de/das_gelbe_untersuchungsheft
Wir können lernen, die Angst vor Unterschieden zu verlieren.
Kein politischer Wille für eine unabhängige Überprüfung der Sonderschulen
Nach dem spektakulären Prozessgewinn von Nenad Mihailovic gegen das Land NRW verdichten sich Hinweise, dass sich in den Sonder-/Förderschulen für Geistige Entwicklung auch Kinder und Jugendliche befinden, die keine geistige Behinderung haben.
Videos: Zwischen Emanzipation und Vereinnahmung
Die Konferenz Zwischen Emanzipation und Vereinnahmung – Disability Studies im deutschsprachigen Raum vom Oktober 2018 kann man sich nun auf Videos ansehen.
Inklusion im Kulturbetrieb: Theater nicht für alle
Menschen mit Behinderung haben nicht nur das Recht auf Teilhabe in der Arbeitswelt, sondern auch in der Kultur. Das hat Deutschland unterzeichnet.
Konzertbesuch mit Behinderung: Jauchzen verboten
Der Sohn von Birte Müller liebt klassische Musik. Konzerte sind herausfordernd. Nicht weil er tanzt, sondern weil alle anderen stocksteif dasitzen.
So viele falsche Worte
Wenn Menschen mit Beeinträchtigungen Kunst machen, wird es gerade für wohlmeinende Kritiker*innen schwierig: Wie thematisieren, was man eigentlich nicht thematisieren will?
Podcast: „Rampenlicht“ mit Graf Fidi
http://www.diversity-arts-culture.berlin/magazin/rampenlicht-1
Rampenlicht ist ein Podcast zu Behinderung und Kultur. Rebecca Maskos unterhält sich mit behinderten Künstlerinnen und Künstlern über Inklusion und Vielfalt in Musik, Theater, im Tanz und in der Bildenden Kunst und über den Zugang zum Kulturbetrieb. In Folge 1 trifft sie Graf Fidi.
Zehn Jahre Persönliches Budget – eine Erfolgsgeschichte
https://www.teilhabeberatung.de/artikel/zehn-jahre-persoenliches-budget-eine-erfolgsgeschichte
„Rund 90 Prozent der Budgetnehmenden haben den Eindruck, dass sich ihre Selbstständigkeit durch das Persönliche Budget verbessert hat“. So steht es im zweiten Teilhabebericht der Bunderegierung. Mit der Schaffung des Sozialgesetzbuches (SGB) IX im Jahr 2001 hat der Gesetzgeber diese neue Form der Leistung erstmals möglich gemacht, zunächst in Modellversuchen. Ab dem 1. Januar 2008 als Rechtsanspruch im SGB IX verankert, ist das Persönliche Budget zehn Jahre später ein Baustein selbstbestimmter Teilhabe, der aus der Praxis nicht mehr wegzudenken ist.
Reportage zum Bundesteilhabegesetz – Artistik-Ausbildung mit Down-Syndrom
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/mofr1013/_/trainerin-mit-down-syndrom.html
Vor einem Jahr wurde das sogenannte Bundesteilhabegesetz erweitert. „Mehr Jobchancen. Weniger Behindern.“ Damit wirbt das Arbeitsamt seit einem Jahr für das erweiterte Bundesteilhabegesetz. Menschen mit Behinderungen soll der Weg auf den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Wie das so klappt, in der Umsetzung auch dank Initiativen wie BIS Netzwerk für betriebliche Integration und Sozialforschung e. V., hat sich Cora Knoblauch angeschaut.
Mitarbeiter beklagt sich: Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung zahlt wenig
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/duisburg-fall-rogg-schwerbehinderte-klagen-an-100.html
Markus Küpper beklagt sich über zu geringe Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen bei der WfbM
Lebenshilfe NRW und fordert angemessene Vergütung.
Blogempfehlung: Herr Bock – Die Depression hat mich bestimmt. Jetzt bin ich dran. Vielleicht.
Markus Bock spricht ganz offen über seine Depression, Überlebensstrategien und Hilfestellungen.
Blogparade Was darf man Kindern zutrauen?
https://lydiaswelt.com/2018/12/16/blogparade-was-darf-man-kindern-zutrauen/
Wenn es um Erziehung, Kinder und Familienstrukturen geht, streiten sich die Geister unentwegt. Lydia Zoubek findet es immer wieder erstaunlich wie viele Menschen eine Meinung dazu haben und ruft zur Blogparade auf.
Zum Braille-Tag 2019 – brauchen wir einen neuen Louis Braille?
http://www.oliveira-online.net/wordpress/2019/01/04/zum-braille-tag-2019-ein-verlorenes-jahrzehnt/
Schaut man sich die Entwicklung von Braille in den letzten Jahrzehnt an muss man leider feststellen, dass sich unheimlich wenig getan hat. Es wird heute mehr darüber gesprochen und es gibt eine ganze Reihe mehr Produkte mit Braille, aber das Killer-Feature blieb aus. Das wird vielleicht deutlicher, wenn wir uns anschauen, was in anderen Gebieten so alles passiert ist: Smartphones, 3D-Drucker, Geräte mit Sprachsteuerung, eBook-Reader auf eInk-Basis… Was muss also passieren? Domingos de Oliveira hat dazu etwas gebloggt.
Handicap-Passion – Über BDSM und Behinderung
https://sexabled.de/2019/01/04/handicap-passion-uber-bdsm-und-behinderung/
Eine Behinderung zu haben und BDSM zu mögen und zu betreiben ist kein Widerspruch! Ein Mensch mit einer Behinderung kann dominant oder devot sein wie ein Mensch ohne Handicap auch. Einzelne BDSM-Praktiken können für gewisse Behinderungen auch durchaus entspannende Aspekte bieten und dazu beitragen, dass sich die Person besser auf die Situation einlassen kann.
Drei Menschen erzählen, wie ihre Querschnittslähmung ihr Sexleben verändert hat
Ein Leben im Rollstuhl macht Geschlechtsverkehr zu einem relativ komplizierten Unterfangen. Es kann einem aber auch neue Möglichkeiten im Bett aufzeigen.
For China’s Disabled People, Sex is Still Taboo
https://www.sixthtone.com/news/1003361/for-chinas-disabled-people%2C-sex-is-still-taboo
While the country is paying more attention to employment and health care, the need for intimacy is still often ignored.
Peruvian driver with Down Syndrome set to make history at the Dakar Rally
Peruvian driver Lucas Barrón will be making history when the 2019 Dakar Rally kicks off in Lima in a few days. The 25-year-old driver is set to become the first-ever participant in the history of the famed off-road race with Down Syndrome.
Dad Creates Autcraft, a Safe Minecraft Server for Those With Autism
https://themighty.com/2017/05/autcraft-minecraft-autism-stuart-duncan/
When Stuart Duncan started Autcraft, a private Minecraft server for people on the autism spectrum, he had no idea it would become the community it is today.
Why Sign-Language Gloves Don’t Help Deaf People
Wearable technologies that claim to translate ASL overlook the intricacies of the language, as well as the needs of signers.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: 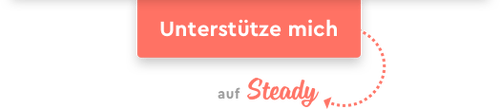
January 5, 2019
Eine schleichende Gefahr namens Crowdfunding. Oder: Warum wir die Probleme an der Wurzel anpacken müssen.

Immer öfter erreichen mich Spendenanfragen via Crowdfunding für Assistenzhunde, Rollstühle oder barrierefreie Autos und seit Neuestem auch Assistenz. Der Staat oder die Krankenversicherungen weigern sich zu zahlen. Sind das gute Zeichen an der Wand?
Manches Unbehagen kommt durch die Hintertür, und gut versteckt ist es auch, verborgen hinter Worten, die eigentlich nur grundgut klingen – so wie „Crowdfunding“. Ich selbst habe oft eine Schwäche für diesen Begriff, sah und sehe in der Schwarmfinanzierung ein faszinierendes Instrument der Selbstermächtigung guter Ideen, die ansonsten kaum wüchsen. Doch es gibt auch eine andere Seite.
Immer öfter erhalte ich Anfragen mit der Bitte um Verbreitung zur Beteiligung an Spenden, schließlich habe ich selbst einige Projekte über den Schwarm angeschoben. Doch was, wenn es um die Finanzierung eines elektrischen Rollstuhls für von MS Betroffene geht, oder um eine Zwangsräumung von Mietern mit Behinderung zu verhindern? Wenn die Deutschland-Seite der Crowdfunding-Plattform „Gofundme“ 179 Einträge zum Suchwort „Rollstuhl“ präsentiert, beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Denn dass Crowdfunding dort einspringen soll, wo sich der Staat aus seiner Verantwortung zurückzieht, ist für mich kein verheißungsvolles Zukunftsszenario.
In den USA ist Crowdfunding von Gesundheitsbelangen längst Alltag. Da sammeln Leute, die das Pech haben eben nicht reich zu sein, verzweifelt Geld für ihre Insulindosen ein, welche sie als Diabetiker dringend benötigen. Steht eine Krebsoperation an – wird erstens die Kreditkarte leergeräumt und zweitens der Crowdfundingaufruf formuliert. Dies liegt natürlich an den Gesundheitskosten in den USA, welche höher sind als in Deutschland, und am schlechteren Krankenversicherungswesen. Aber wir sollten uns schon heute darüber Gedanken machen, wie die aktuellen Verhältnisse in Amerika keine Vorboten für die unsrigen werden.
Kurz und knapp: Je schwächer das Engagement des Staates für seine Bürger, desto stärker die Bemühung dies durch Crowdfunding auszugleichen.
Im Grunde handelt es sich um Crowddonating – bei Funding denkt man an kreative Ideen, an Nischenprojekte, denen zum Durchbruch verholfen wird, indem sich viele „kleine Leute“ zusammentun, um den Unbeweglichen da oben eines auszuwischen; es geht darum sich an einer „Aktion“ zu beteiligen und sich gut dabei zu fühlen. Und das auch oft zurecht.
Wenn schließlich Bedürftige vor Unrecht bewahrt werden, dokumentiert dies auch die Stärke und innere Solidarität in Communities wie an Diabetes Erkrankten. Nur bergen diese Aktionen nur einzelne Lösungsversuche, strukturell oder nachhaltig sind sie nicht. Spenden sollen in der Not helfen, aber keinen tragischen Normalzustand reparieren.
Natürlich bleibt Crowdfunding eine soziale Grunderrungenschaft des Netzes, und es existierte auch bereits davor: Im 19. Jahrhundert wurde der Sockel der Freiheitsstatue von New York durch 160.000 Einzelspenden finanziert – symbolischer gelingt eine Selbstermächtigung kaum. Aber in gesundheitlichen und anderen freiheitlichen Belangen geht es auch ums Recht.
Vielleicht hatten die New Yorker vor 130 Jahren nicht den ultimativen Anspruch auf eine 92,99 Meter hohe Freiheitsstatue in ihrem Hafen; ein Recht auf angemessene Versorgung mit Insulin oder die möglichst beste Turmorbehandlung aber haben sie schon. Ebenso halte ich es in Deutschland für ein absolut gesetztes Recht, dass an MS Erkrankte von der Kasse einen elektrischen Rollstuhl gestellt bekommen, wie ich es für ein absolut gesetztes Unrecht halte, wenn Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, wegen fehlgeleiteter Mietzahlungen vor die Tür gesetzt werden.
Es ist auch nicht schwer zwischen Bedarf und Luxus zu unterscheiden. Ein kurzer Blick auf Spendenprojekte bei „Gofundme“ in Deutschland: Für Kinder mit schweren Behinderungen ist eine Tiergestützte Therapie kein Freizeitspaß, sondern manchmal notwendig. Der Umbau des Familienautos nach behinderungsgerechten Maßstäben ist auch kein Autotuning. Wenn dagegen für einen Offroad-Rollstuhl zum Befahren des Jakobweges gesammelt wird, ist das sicherlich ein tolles Projekt, aber nicht unbedingt ein Fall für die Krankenversicherung. Wir sollten nicht leichtfertig hinnehmen, wenn sich über die Hintertür des Crowdfunding Kasse und Staat die Gelegenheit eröffnet sich aus ihren Pflichten zu stehlen.
In Amerika kämpfen Menschen mittels Crowdfunding ums Überleben. In Deutschland sorgt sich Crowdfunding ums Wohl von an Diabetes erkrankten Katzen oder um die Finanzierung eines Diabetikerwarnhundes – noch. Stellen wir sicher, dass dem so bleibt.
Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen: