Axel Hacke's Blog, page 5
March 26, 2023
Die Kindergrippe
Leser N. schickte mir diesen Screenshot eines Inserats auf Immowelt.
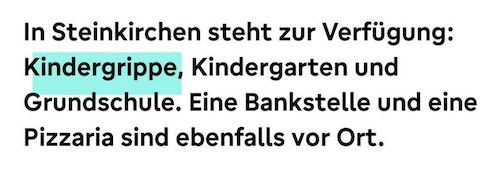
Ich postete das auf meiner Facebook-Seite im Rahmen einer kleinen Rubrik, die Neues aus Sprachland heißt, und schrieb dazu, meines Wissens stehe die Kindergrippe in diesem Frühjahr aber in ganz Deutschland zur Verfügung, nicht bloß in Steinkirchen. Auf das schöne Wort Bankstelle ging ich nicht weiter ein, es war wohl eine Bankfiliale gemeint, aber man denkt natürlich auch an Tankstelle und stellt sich eine Geld-Zapfanlage vor, wo die Hunderter aus dem Hahn kommen. Oder eine Bank, bei der es auch Kekse, Chips, Weißbier und belegte Brote gibt. Darauf verfassten viele Leserinnen und Leser ihre Kommentare. Eine klagte: „Ich finde diese Beiträge immer sehr überheblich. Schon wie im Hohlspiegel. Billige Lacher, im Zweifel auf Kosten von Ausländern, die sich mit der deutschen Sprache rumschlagen. Oder Schülern, die das Abi nicht geschafft haben.“ Ich überlegte, ob ich der Leserin mit einem Zitat aus Wumbabas Vermächtnis antworten sollte:
Nun sind die Wenigsten, die einen Liedtext falsch verstehen, schwerhörig; meist liegt das Problem beim Sänger oder bei den Sprachkenntnissen, oft ist es auch nur so, dass man sich an den Text eines Liedes nicht mehr recht erinnert, es aber trotzdem singen möchte. Dann singt man aus der Erinnerung.Aber peinlich ist es den Meisten immer noch, etwas falsch verstanden zu haben. Es ist eine Fehlleistung, und Fehlleistungen sind in einer Leistungsgesellschaft unangenehm. Umso wunderbarer ist Wumbabas Existenz: eine Instanz, vor der man seinen Irrtum leichten Sinnes eingestehen kann. Sein Vermächtnis lautet: Wumbaba verurteilt nicht. Wumbaba lacht.Denn Wumbaba weiß: Was die Menschen am meisten eint, sind ihre Fehler. Und wenn Fehler so komisch oder so poetisch oder, im besten Fall, so poetisch-komisch sind wie hier, dann gibt es keinen Grund, über Fehler nicht zu reden. Im Gegenteil.
Habe ich aber nicht gemacht. Ich überlegte, wie es mit einem Zitat aus Oberst von Huhn bittet zu Tisch wäre, der Stelle nämlich, die kommt, nachdem ich einen Fund auf einer griechischen Speisekarte erläutert hatte. Dort gab es im deutschsprachigen Teil eine Speise namens Zwiebel ruft an. Im Englischen hieß sie onion rings.
Und damit wollen wir uns beschäftigen, mit den ganz und gar großartigen Veränderungen des Deutschen im Ausland und der besonderen Erscheinungsform, die unsere Sprache außerhalb des Landes und dort besonders an Tischen und in Küchen annimmt. Im Grunde auch: mit der Sprache in den Zeiten der Globalisierung.
Man macht einen sehr großen Fehler, wenn man nur das Falsche daran sieht. Denn in dem, was wir auf diesen Speisekarten lesen, offenbart sich uns das Deutsche auf eine ganz neue Weise, von jedem Sinn und allem Ballast irgendeiner Bedeutung befreit, als reiner Klang und voller Witz, ja, man hat das Gefühl, als fände das Deutsche erst außer-halb Deutschlands zu sich selbst, gelöst aus den Fesseln der Grammatik.
Habe ich auch nicht gemacht. Ich überlegte, ob ich aus dem Wortstoffhof zitieren sollte.
Sie sehen: Es geht hier um nichts anderes als um den Spaß am Valschen, die Poesie des Irrtuhms, die Freude an der Fehlleistunck – um einen Reichtum also, der erst durch menschliche Schwäche entsteht. Von welchem anderen Reichtum könnte man dies behaupten? …Wir haben es, ganz klar, mit einer Ausformung deutscher Sprachleidenschaft zu tun, die ich besonders erfreulich finde, weil sie sich nicht in Besserwisserei und den anderswo beliebten Falsch-Richtig-Kategorien äußert. Sprachkritik sollte ja, finde ich, nicht darin bestehen, sich über die lustig zu machen, die es nicht besser können. Sondern sie hat sich, wenn schon, die vorzunehmen, die es nicht besser wollen, die also Sprache als Imponierinstrument oder zur Verschleierung ihrer wahren Absichten benutzen. Oder die einfach zu faul sind, das Richtige zu sagen.Und, um auch dies gleich mal zu sagen: Ich halte nicht viel von denen, die das Deutsche „pflegen“ wollen, als sei es ein Patient. Oder die nach aussterbenden Wörtern suchen, als wäre die Sprache ein bedrohtes Ökosystem, und die den Verlust des Wortes „Backfisch“ dem Aussterben des Kabeljaus gleichsetzen. In Wahrheit stehen bei uns, wenn ein Wort ausstirbt, doch gleich zwei neue an der nächsten Straßenecke und noch im letzten Ich-mach-dich-Messer-Dialog zweier Neuköllner Türkenjungs steckt mehr von der Kraft des Deutschen als in den Teilnehmern betulicher Sprachhütertagungen. Wir vom Wortstoffhofversuchen Tag für Tag, in neue Sprachdimensionen vorzudringen. Und fragen uns, wie sehr eine Sprache gerade durch das Falsche bereichert wird.
Habe ich aber auch gelassen. Ich überlegte: Soll ich einfach schreiben, ob sie, die Leserin, denn nicht einmal, ein einziges Mal nur über diese ganzen ewigen Kränkungsängste und Verletzungsphobien und Erniedrigungsphantasien hinwegsehen und sich einfach dem Spiel mit und dem Spaß an der Sprache überlassen könne!? Denn wenn ich mich wirklich nur über den erheben wollte, der Kindergrippe geschrieben hat, dann hätte ich doch wohl auch bemängelt, dass es stehen statt steht hätte heißen müssen und auch nicht Pizzaria. Aber das sei eben nicht witzig. Witzig sei nur Kindergrippe. Habe ich auch unterlassen. Kaum war ich mit Grübeln fertig, schrieb eine andere Leserin auf Facebook an die oben Zitierte: „Ich persönlich lache nicht über den, der den Fehler gemacht hat (ich weiß ja nicht mal, wer das ist), sondern über den Fehler an sich, der nun mal zu sehr lustigen Assoziationen führt. Deshalb finde ich es ganz und gar nicht überheblich (sagt ja auch niemand, dass man es selbst bestimmt besser gemacht hätte) und absolut nicht auf Kosten von irgendjemandem.“
Man muss nur warten können, dann tun die Leserinnen und Leser alles selbst.
Michael Maar, Fliegenpapier. Vermischte Notizen. Rowohlt
In der Post ist ein kleines Buch, Mit herzlichen Grüßen von Michael Maar, den ich zu meinem Bedauern persönlich gar nicht kenne. Aber die Presseabteilung des Rowohlt-Verlages schickt mir trotzdem und zu meiner Freude dieses Werk: Fliegenpapier.
Selbstverständlich schaue ich sofort nach, was das ist, ein Fliegenpapier, und entdecke: Damit sind diese klebrigen Streifen gemeint, die man früher (und manchmal noch heute) aufhängte (oder eben aufhängt), damit an ihnen die lästigen Fliegen hängenblieben und -bleiben.
So geht es mir seitdem mit dem Buch. Es liegt neben einem Sessel und bisweilen, wenn ich mich in diesen Sessel fallenlasse, lese ich darin und bleibe selbstverständlich hängen, länger als ich wollte, weil das Buch so unterhaltsam ist. Bloß, im Gegensatz zur Fliege: Ich schwebe doch irgendwann wieder davon und tue meine Dinge, froh, keine Fliege zu sein, sondern mich durch das Buch in erheitertem Zustand zu befinden.
Maar ist Germanist, Kritiker und vielmals ausgezeichneter Schriftsteller. Vor drei Jahren habe ich sein wirklich tolles Buch Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literaturgelesen, auch ein Werk übrigens, das man immer mal wieder und so zwischendurch lesen kann, eine Art von spielerischer, vergnüglicher und bildender Literaturgeschichte.
Fliegenpapier ist etwas anderes, eine kleine Sammlung von Notizen, Lesefrüchten, Anekdoten, Aphorismen, alles so neben der Arbeit und mitten im Leben entstanden. Maar hat seinen Stoff überall gefunden, beim fränkischen Sparkassenberater einerseits, der auf den Seufzer, man müsse vom Telefon- nun wohl jetzt zum Online-Banking wechseln, mit dem Satz „Ja, das ist jetzt der Zahn der Zeit“ reagiert, bis, andererseits, zu einer Fußnote in irgendeinem Werk Peter Sloterdijks, der Paul Valéry zitiert: Gott habe die Welt aus dem Nichts geschaffen. Aber das Nichts schimmere durch.
Solche Bücher muss man überall liegen haben, Zwischendurch-Lektüren, Kolumnen von Doris Knecht, Ina Strübel oder Kathrin Passig, Heinz Berggruens, des großen Galeristen, Spielverderber, nicht alle oder, vor langer Zeit, Werner Fulds erfundene Kafka-Anekdoten, geistige Imbisse quasi, nicht große Gerichte. Maar schreibt im Vorwort, seine kleinen Texte seien nach keinem anderen Prinzip geordnet als dem der Petersburger Hängung.
Das musste ich selbstverständlich auch nachschauen und las bei Wikipedia, mit dem Begriff sei eine besonders enge und dichte Hängung von sehr viele Gemälden gemeint, das Wort gehe auf die üppig bestückten Wände der Sankt Petersburger Eremitage zurück. Und dann: „Objekt der Bewunderung ist letztlich nicht das einzelne Bild, sondern derjenige, der über die Mittel verfügt, eine große Kunstsammlung zusammenstellen zu können.“
Ja, Maar hat diese Mittel, und ich bewundere ihn dafür, mit großem Vergnügen und auch voller Neid auf dieses große Wissen, das überall seine Quellen hat und aus allen schöpft, und das er uns hier mal so eben zur Verfügung stellt.
Michael Maar, Fliegenpapier. Vermischte Notizen. Rowohlt. 20 Euro
March 5, 2023
Johannisbeeren
Erstaunlich ist, wie weit Johannisbeeren rollen können. Ich zupfe einige von ihnen in mein Frühstück, drei fallen zu Boden und hören nicht auf zu rollen, wie gut aufgepumpte Bälle, sicher fünf Meter weit, bis sie unter dem Schrank angekommen sind, wo sie sich meiner Aufmerksamkeit zu entziehen versuchen. Morgen probiere ich mal Haselnüsse, also, wie weit die rollen, meine ich.
February 26, 2023
Die Bettlerin
Neulich abends hatte ich eine Besprechung samt Abendessen im Schumann’s, nach wie vor einer der Hauptschauplätze des Luxus und der Moden in München. Auf dem Heimweg durch die Stadt begegne ich vor einem der richtig guten Modegeschäfte in der Brienner Straße einer kleinen Frau mittleren Alters, also, sagen wir, Ende vierzig, nicht schlecht gekleidet in einen dunkelblauen Winteranorak, Strickmütze auf dem Kopf.
Sie kommt auf mich zu. Ob ich etwas Geld für sie hätte, für etwas Warmes zum Essen.
Normalerweise gebe ich Leuten, die mich so anreden, nichts. Das mag falsch sein, vielleicht ist es auch richtig. In München gibt es seit Langem organisierte Bettlerbanden, deren Angehörige das Geld abends irgendeinem Chef abliefern müssen, das führt zu nichts Gutem. Und einem Drogensüchtigen seine Sucht zu finanzieren davon halte ich auch nichts. Ich spende lieber Geld dorthin, wo ich weiß, dass es wirklich vernünftig verwendet wird.
Aber dieser Frau gebe ich auf der Stelle fünf Euro.
Seltsam, nicht wahr? Sie ist von der Kategorie her nicht schlechter angezogen als einige Freundinnen von mir. Morgen könnte ich sie als Ärztin in irgendeiner Praxis wieder treffen, als Lehrerin oder vielleicht evangelische Pastorin.
Irgendwie denke ich, wer so gekleidet um Geld bettelt, muss es wirklich nötig haben. Vielleicht ist es auch einfach eine Art von Identifikation: Wenn sie um Geld bettelt, vielleicht bin dann morgen ich es, der die Leute anquatschen muss.
Ich schaue ihr noch lange nach. Sie geht weiter durch die menschenleere Straße abends um elf, schaut in die Schaufenster. Warum geht sie nicht in die Fußgängerzone, wo auch um diese Zeit noch Leute sind, von denen man etwas bekäme? Nein, sie geht immer weiter, allein.
February 24, 2023
Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. rororo
Ich meine, liebe Freundinnen und Freunde, wie seltsam ist das denn hier?!
Am Tag nachdem ich der Bettlerin (siehe ganz oben) gegen meine Gewohnheit etwas gegeben hatte, lese ich in Wolfgang Herrndorfs Arbeit und Struktur den Satz: „Wenn mit Lebenden einmal so pietätvoll umgegangen würde wie mit Toten oder Sterbenden oder wenigstens ein vergleichbares Gewese drum gemacht würde.“
Dann: „… die zusammengeschrumpelte, achtzig- oder neunzigjährige Frau zwischen Chaussee- und Invalidenstraße, ein kleines Becherchen vor sich auf dem Trottoir, durchaus nicht verwahrlost, keine mitgeführten Plastiktüten, vermutlich nicht mal obdachlos.
Entschließt sich zu ihrer Tat, wenn ich das richtig sehe, nur sehr unregelmäßig und im Abstand einiger Wochen, wenn das Hartz IV oder was auch immer verbraucht ist.“
Dann: „Für gewöhnlich gebe ich Bettlern nichts, wenn ich nicht Münzen direkt griffbereit habe, aber wegen dieser Frau musste ich schon zweihundert Meter zurücklaufen, die zieht mir völlig den Stecker. Vor allem das Gesicht, wo man sieht: unverschuldet, Altersarmut, Hölle.“
Jeden Tag lese ich in Herrndorfs Buch, das posthum erschienen ist, entstanden aus einem Blog, einem Internet-Tagebuch, das er von 2010, nachdem bei ihm ein bösartiger Hirntumor festgestellt worden war, bis zu seinem Suizid 2013 führte, zunächst einfach, um Freunde und Bekannte auf dem Laufenden zu halten und nicht jedem immer alles extra sagen zu müssen, dann halt auch als Projekt.
Für den Fall, dass jemand der Name Herrndorf nichts sagt: 1965 in Hamburg geboren, Maler und Illustrator, Mitautor des Internetforums Wir höflichen Paparazzi und des Weblogs Riesenmaschine (habe ich alles immer gerne gelesen), dann unter anderem der Romane Tschick (ein Jahr Bestsellerliste, verfilmt, Riesenerfolg, großer Erfolg auch im Theater in der Fassung von Robert Koall, der auch die Theaterfassung meines Buches Die Tage, die ich mit Gott verbrachte schrieb) und Sand (Preis der Leipziger Buchmesse, Shortlist Deutscher Buchpreis). Alles Bücher übrigens, die er vor seinem Tod noch schreiben konnte, weil er nach der Diagnose seines Glioblastoms so strukturiert weiterarbeitete, wie er es in Arbeit und Struktur beschreibt, und die erschienen, als er schon von seiner Krankheit wusste.
Im August 2013 starb er.
Ein großartiges Buch. Ich hatte lange Angst davor, es zu lesen. Kann man vor einem Buch Angst haben? Aber ja, wenn es um Leben und Tod in Wirklichkeit geht, und es geht ja hier auch um alles, seine Arbeit, seine Krankheit, die Diagnosen, die Behandlungen, die Operationen, die Anfälle, seinen Alltag und wieder seine Arbeit. „Es gibt in der Geschichte der Tagebücher nichts, was ihm gleichkäme an Takt, Wärme, dunklem Witz, Sarkasmus und stillem Grauen“, hat der Literaturkritiker Michael Maar darüber geschrieben, man zitiert es im Klappentext.
So ist es. Wärme, dunkler Witz, stilles Grauen.
Es liegt gerade immer vor meinem Lesesessel im Büro. Manchmal lasse ich mich in einer Pause in den Sessel fallen, lese fünf Minuten Herrndorf, dann geht es weiter mit dem Schreiben. Soviel zur Struktur der Arbeit bei mir.
Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. rororo. 12 Euro
February 13, 2023
Georges Simenon, Maigret und der Fall Nahour, Kampa Verlag
Ich arbeite zur Zeit, wie gesagt, am nächsten Buch. Das gibt es manchmal Phasen, in denen ich ziemlich nervös bin. Lesen muss mich dann beruhigen. Und ich kann mich oft nicht auf ein anderes Buch einlassen, es stört mich einfach, die Texte anderer zu lesen. In solchen Zeiten sehe ich abends oft einfach eine Serie auf Netflix oder anderswo, gerade zum Beispiel Succession, die fiktive Geschichte der ebenso reichen wie kaputten Familie des Medienmoguls Logan Roy, der eines der größten Unterhaltungs- und Nachrichtenunternehmen der Welt kontrolliert.
Kann ich nur empfehlen.
Gelesen habe ich den Autor, den ich immer lesen kann und immer lesen werde, mag die Lage sein, wie sie gerade sei: Georges Simenon. Ich habe schon oft erklärt, warum ich ihn verehre, einmal habe ich sogar im Fernsehen darüber gesprochen, mit dem Ergebnis, dass nach der Sendung eine ältere Dame vor dem Studio stand – mit einer großen Tasche voller Maigret-Romane, erschienen damals bei Diogenes. Sie habe ihr Bücherregal verkleinern müssen, sagte sie, aber die schönen Bücher nicht wegwerfen wollen.
Ob ich sie gerne hätte?
Klar wollte ich. (Man kann so ein Angebot ja auch nicht ablehnen.) Seitdem liegt der Stapel in meinem Büro. Und als ich gar nicht mehr wusste, was ich lesen sollte, schnappte ich mir einfach das oberste Exemplar und nahm es mit heim.
Maigret und der Fall Nahour, das ist 1967 zum ersten Mal erschienen.
Selbstverständlich kannte ich das Buch, weil ich praktisch alles von Simenon kenne, für den Kampa-Verlag, der sein Werk nach und nach in frischen Übersetzungen neu herausbringt, habe ich sogar einmal ein Nachwort für Der Mann, der den Zügen nachsah geschrieben. Ich empfand das als große Ehre: mein Name und der Simenons auf einem Buchtitel.
Aber ich vergesse den Inhalt gerade von Kriminalromanen immer sehr schnell und so las ich das Buch wie ein neues. Ich ließ mich fallen in die Welt Maigrets, in die klare, einfache, unprätentiöse und bildreiche Sprache Simenons, in die bekannte Welt des Quai des Orfèvres, der Brasserie Dauphine, der Wohnung am Boulevard Richard-Lenoir, der Inspektoren Lucas, Lapointe und Janvier. Ungeheuer entspannend – und spannend zugleich. (Ja, auch das können Bücher für uns tun.)
Georges Simenon, Maigret und der Fall Nahour, Deutsch von Hansjürgen Wille, Barbara Klau und Julia Becker, Kampa Verlag. 17,90 Euro
February 5, 2023
Das erste Faxgerät.
Ich kann mich gut an das erste Faxgerät erinnern, das ich benutzte. Es war kommodengroß und stand im temporären Büro, das die Süddeutsche Zeitung gemeinsam mit den Salzburger Nachrichten und dem Zürcher Tagesanzeiger bei der Ski-Weltmeisterschaft 1982 in Schladming unterhielt.
Das Beste aus aller Welt 2021
December 29, 2022
Friedrich Torberg, Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten, dtv
Manchmal werde ich nach meinen Lieblingsbüchern gefragt. Ich nenne zum Beispiel Bohumil Hrabals Schöntrauer und Carson McCullers‘ Die Ballade vom traurigen Café, zwei Werke, die viel zu wenige Menschen kennen.
Was mich aber wirklich schmerzt, das ist: Wenn ich Friedrich Torbergs Die Tante Jolesch erwähne und Leute dann sagen, sie hätten davon nie gehört.
Es ist schlimm, nein, es ist schlimmer: Es ist traurig.
Friedrich Torberg, 1908 in Wien geboren und 1979 dort gestorben, war Schriftsteller und Journalist, Drehbuchautor und Publizist, Polemiker und Übersetzer (von Ephraim Kishons Büchern nämlich), ein, wie er das selbst nannte, tschechischer Österreicher und Jude, Emigrant und Antikommunist. Er hat mindestens einen großartigen Roman geschrieben, Der Schüler Gerber, konnte vor den Nazis noch gerade eben so in die USA fliehen, kehrte 1951 nach Wien zurück, blieb aber us-amerikanischer Staatsbürger. Seine Frau Marietta, mit der er 17 Jahre lang verheiratet war, sagte einmal über ihn, er bestehe „zu mindestens fünfzig Prozent aus Humor“. Auf dem Wiener Zentralfriedhof liegt er in einem Ehrengrab, neben Arthur Schnitzler übrigens, das war sein Wunsch.
Die Tante Jolesch hat den Untertitel Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten, was einerseits ironisch auf Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes anspielt, andererseits die Hauptform des Buches annonciert: die Anekdote eben.
Dies ist ein geistreiches, unglaublich komisches, weises, wehmütiges, melancholisches, heiteres, reiches und gerade deshalb auch trauriges Buch. Denn die Welt, die Torberg schildert, die des jüdischen Bürgertums in Österreich, Ungarn und Prag, die gibt es selbstverständlich nicht mehr. Es war die Welt von Egon Erwin Kisch, Franz Molnár, Alfred Polgar, Max Brod (der übrigens Torbergs Entdecker war), es war die des Prager Tagblatts, eines Kellners namens Neugröschl und eines Religionslehrers namens Grün und des Journalisten Tschuppik, der davon träumte, eine Tageszeitung namens Der Arsch zu gründen, die dann von den Verkäufern abends den aus der Oper Herauseilenden mit tonlos geschäftsmäßiger Stimme angepriesen würde: Der Oasch ... der Oasch ... der Oasch.
Den Anwalt Sperber möchte ich erwähnen. Der verteidigte einmal einen Einbrecher, dem zwei Taten zur Last gelegt wurden, eine bei Tag begangen, eine im Schutz der Nacht. Der Staatsanwalt prangerte die Frechheit des Mannes an, der am helllichten Tag einbreche, wenn niemand damit rechne, dann wieder im Schutz der Dunkelheit – worauf Sperber ihn mit den Worten unterbrach: „Herr Staatsanwalt, wann soll mein Klient eigentlich einbrechen?“
Mehr erzähle ich nicht. Lesen Sie bitte das Buch endlich, wenn tatsächlich auch Sie es noch nie gelesen haben sollten, bitte!
Friedrich Torberg, Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten, dtv, 12 Euro
December 25, 2022
Der Feuerwehrmann hinter der Bühne
Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Aber ich will jetzt keine Weihnachtsgeschichte erzählen. Bloß ein einfaches Erlebnis, das ich neulich hatte.
Vor drei Wochen fand meine jährliche Lesung im Berliner Schlossparktheater statt, einem Haus, das ich sehr mag, weil es eine große Tradition hat, weil es seinem Chef Dieter Hallervorden gelingt, dieses Haus in privater Initiative auch durch schwere Jahre zu bringen, weil dort unglaublich freundliche und professionelle Menschen arbeiten und weil auf dieser Bühne jahrelang Der kleine König Dezember als Theaterstück in der Regie von Lorenz Christian Köhler lief. (Zuerst sollte damals Dirk Bach die Titelrolle spielen, was die Idealbesetzung gewesen wäre, doch starb er wenige Tage vor der Premiere, zehn Jahre ist das her. Gustav Peter Wöhler sprang für ihn ein, vorbildlich und großartig.)
Wie bei jeder Theaterveranstaltung saß bei meiner Lesung hinter der Bühne ein Feuerwehrmann, das ist so vorgeschrieben. Im Brandfall muss er die notwendigen Maßnahmen treffen. Einmal, im Bochumer Schauspielhaus, habe ich das sogar erlebt: Bei der Zugabe schrillte plötzlich die Feuersirene, das Haus wurde geräumt – glücklicherweise war es falscher Alarm.
Bevor die Lesung beginnt, unterhalte ich mich oft mit dem Diensthabenden, manchmal ist es ein Berufsfeuerwehrmann, oft einer von der Freiwilligen Feuerwehr. Man erfährt interessante Sachen über deren Alltag, macht ein paar Scherze, dann geht es los. In der Regel scheinen die Feuerschützer aber nicht so wahnsinnig interessiert am Bühnengeschehen, sie sehen es ja auch gar nicht, allenfalls auf dem kleinen Bildschirm des Inspizienten.
In Berlin schob ein älterer Herr Dienst.
Als ich zur Pause von der Bühne kam, stand er auf einmal direkt vor mir.
„Mann!“, rief er, „Sie sind ja echt wer! Ich wusste das nicht, ich kannte Sie nicht.“ Er hielt mir seinen Handy-Bildschirm unter die Nase, darauf mein Foto. Er hatte meinen Namen gegoogelt und war ganz aus dem Häuschen vor Freude, es sei ja toll, was ich da so läse und erzählte, „und wie Sie das alles so bringen, super“. Er hörte gar nicht mehr auf zu reden, aber ich musste ins Foyer und am Büchertisch signieren.
Ich freute mich sehr. Nach der letzten Zugabe stand ich wieder vor ihm. Draußen hatten sie zu klatschen aufgehört, jetzt klatschte er mir hinter der Bühne zu und ich sage Ihnen: Es hat mich fast mehr gefreut als der Beifall aus dem Zuschauerraum. Denn vom Publikum erwartet man solchen Jubel, von Feuerwehrleuten nicht. Ich hatte mit meiner Arbeit einen für mich eingenommen, von dem ich das nicht im Geringsten erwartet hätte.
Und noch etwas anderes dachte ich.
Dass nämlich wir, die wir etwas auf einer Bühne tun, recht selbstverständlich Beifall erwarten und dass ich ihn in der Regel auch reichlich bekomme. Trotzdem klage ich immer wieder, es sei mir zuviel, die vielen Auftritte und Reisen. Stimmt auch, es ist mir manchmal wirklich zuviel. Aber es gibt eben eine Menge Leute, die nicht weniger Arbeit haben – aber ohne jeden Beifall. Das letzte Mal, dass zum Beispiel Leuten Beifall gespendet wurde, die damit sonst nicht rechnen können, war irgendwann zu Beginn der Pandemie, nicht wahr? Hat man schon wieder vergessen. War ja auch bald vorbei.
Könnte man sich aber mal wieder dran erinnern. Man muss nicht immer die Hände rühren, aber ein täglich geäußerter Respekt und wirklich ausgesprochene Anerkennung für Leute, die ohne großes Trara irgendwo ihre Arbeit tun und ohne die es halt nun mal nicht ginge – das wäre schön. Braucht nämlich jeder. Kann auch jeder geben, ohne große Mühe. Jetzt ist es doch irgendwie weihnachtlich geworden. Besinnlich, wie man so sagt. Mir war halt so.
November 26, 2022
Der Mut der frühen Stunde
Der Schweizer Autor Lukas Bärfuss, den ich sehr schätze, hat kürzlich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein langes Interview gegeben. Es ging um den Reichtum der Schweiz, seine von Armut geprägte Kindheit, auch um seinen Vater, der im Gefängnis saß. Und von den fünf Jahren, die er selbst auf der Straße lebte, war die Rede. Vor mehr als dreißig Jahren bekam er dann eine Stelle in der Comics-Abteilung einer Berner Buchhandlung, wo er kündigte, als er 26 war. Danach begann sein Leben als Schriftsteller. Schon vorher habe er, so Bärfuss, neben der Arbeit im Laden, „wie ein Irrer“ geschrieben – und vor allem ein paar wichtige Lektionen gelernt.
„Ich wusste, woher ich kam“, sagte Bärfuss. „Und ich wusste, dass jeden Tag ziemlich viele Idioten aufstehen. Ich musste bloß ein bisschen früher auf sein. Es ist ein entscheidender Überlebensvorteil, wenn du täglich zwei Stunden Vorsprung hast.“
Warum?, wurde er gefragt.
Antwort: „Erstens braucht Schreiben Zeit, viel Zeit, und zweitens gibt es den Mut der frühen Stunden. Schreiben braucht Courage, die Dinge rücksichtslos zu denken und auszusprechen. Das geht zwischen fünf und sieben Uhr morgens leichter als nach einem langen, zermürbenden Tag.“
Das hat mir gefallen. Ich bin ein Autor vollständig anderer Art als Bärfuss, aber diesen Mut der frühen Stunde kenne ich in der für mich passenden Form auch. Tatsächlich schreibt es sich zu früher Stunde leichter, freier, besser. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man wacher und frischer ist, jedenfalls, wenn man abends vorher nicht zuviel getrunken hat. (Wozu mir einfällt, dass es Autoren gibt, die sich ihren Mut antrinken müssen, ich kenne auch solche. Das sind dann aber nicht jene, die besonders früh aufstehen, im Gegenteil, ihr Mut erwacht ja erst zu später Stunde.)
Da ich zur Zeit ständig auf Lesereise bin, muss ich sogar sehr früh aufstehen, um den Vormittag zum Schreiben nutzen zu können. Die meisten Hotels muss man spätestens um 13.00 Uhr verlassen, und nach dem Mittagessen reise ich in der Regel weiter in die nächste Stadt. Länger als vier oder fünf Stunden kann ich ohnehin nicht schreiben, das passt also ganz gut. Und Mut fassen kann man auch noch um acht, es muss nicht um fünf sein. Wobei man um fünf ungestörter ist, niemand lenkt einen da ab, schlafen ja alle noch.
Einmal, das ist lange her, musste ich als Reporter für die Süddeutsche Zeitung ein ganzseitiges Porträt des Golfspielers Bernhard Langer schreiben, hervorragender Sportler und sterbenslangweiliger Interviewpartner. Ich hatte ihn auf dem schottischen Golfplatz Turnberry getroffen (der heute leider Donald Trump gehört), war mit ihm über den Platz gegangen, aber viel mehr als seine Jas oder Neins hatte ich nicht im Block.
Ich fuhr dann in das schottische Spukschloss, in dem ich ein Bed&Breakfast-Zimmer hatte, trank aus lauter Höflichkeit noch Tee mit dem Schlossbesitzer und aß Toast, den ich aber schon ziemlich verzweifelt hinunterschlang, ich wollte mich ja endlich an diesen schwierigen Text machen.
Dann ging ich in mein Zimmer und begann erst abends um sieben mit dem Schreiben. Es war eine entsetzliche Nacht, eine der schlimmsten meines Lebens. Ich bekam nicht eine einzige vernünftige Zeile zu Papier, riss Blatt um Blatt aus meiner Maschine (ja, ist lange her, man schrieb noch auf Maschinen ...) und saß bis zum Hals in zerknüllten Manuskriptblättern.
Morgens um vier fiel ich in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf, hatte vorher den Wecker auf sechs gestellt, und hackte dann nach einer kalten Dusche in Höchstgeschwindigkeit die erwähnte ganze Zeitungsseite in die Maschine. Es war keine Zierde der Reportagekunst, kein Schmuckstück in meiner Laufbahn als Zeitungsmann. Aber der Text füllte doch die ganze Seite Drei der Süddeutschen.
Nie wieder würde ich erst abends mit dem Schreiben beginnen, beschloss ich. Denn seitdem glaube ich auch an den Mut der frühen Stunde. Obwohl ich in Schottland doch wohl eher vom Mut der Verzweiflung erfasst war.
Axel Hacke's Blog
- Axel Hacke's profile
- 57 followers



