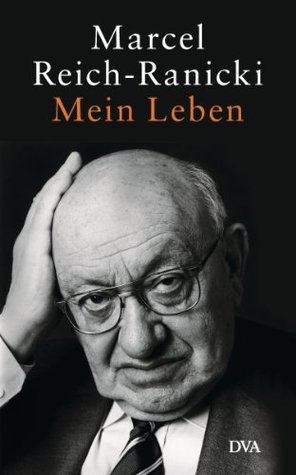Kindle Notes & Highlights
Tschechow
Kurz: Die norddeutsche Blondine kam von der Liebe zur Literatur, ich wollte von der Literatur zur Liebe kommen. Wir trafen uns auf halbem Wege.
Die Balkongespräche machten mir abermals bewußt, daß wir, die stille Fotografin und der unruhige Gymnasialschüler, Bücher lesend, vor allem uns selber verstehen wollten. Da wir beide auf der Suche nach uns selbst waren, entstand eine Gemeinsamkeit, die unserer dialogischen Beziehung eine unverkennbar erotische Note gab, wenn auch beileibe keine sexuelle.
überdies
Wovor ich aber unentwegt Angst hatte, das waren wei-tere gegen die Juden gerichtete behördliche Anordnungen, solche zumal, die mein Leben hätten verdüstern, ja zur Hölle machen können. Täglich suchte ich in der Zeitung – wir abonnierten, da es das »Berliner Tageblatt« nicht mehr gab, die »Deutsche Allgemeine Zeitung« – vor allem Nachrichten über neue judenfeindliche Maßnahmen. Sie fanden sich immer wieder, aber vorerst nicht jene, die mich am meisten angingen: Mich verfolgte der Gedanke, man werde die Juden von den deutschen Schulen vertreiben oder sie zumindest vom Abitur ausschließen. Wie
...more
Das Gebäude der Friedrich-Wilhelm-Universität – nach dem Zweiten Weltkrieg Humboldt-Universität genannt – habe ich seit jenem überflüssigen Besuch beim Rektor im Frühjahr 1938 nicht wieder betreten.
Aber der, wie sich bald herausstellte, sehr kurzen Lehrzeit verdankte ich zweierlei: Sie bewahrte mich vor depressiven Stimmungen, und ich habe damals schnell gelernt, wie ein gut organisiertes Büro funktioniert.
Es gab auch Lokale, in denen man es vorzog, auf solche Aufschriften am Eingang zu verzichten und statt dessen denjenigen Juden, die es wagten, diese Lokale dennoch zu betreten, leere Tassen hinzustellen, bisweilen mit einem Zettel: »Juden raus«. In manchen deutschen Städten waren die Verbotsschilder schon am Ortseingang zu sehen.
Ich war gerade mit Balzacs Roman »Die Frau von dreißig Jahren« beschäftigt.
Ich hatte, wie man sieht, noch keine sehr ernsten Sorgen.
Aber ich wußte nicht, was ich tun sollte. Niemand wußte es. Vom Studium konnte keine Rede sein, schon aus finanziellen Gründen. Und wer sollte mich beschäftigen? Ich war ein arbeitsloser,
Mozarts »Kleiner Nachtmusik«
Freudvoll und leidvoll zugleich – das war meine Situa-tion damals in Warschau. Ich hatte, was Arbeitslose immer haben: viel Zeit.
den zwanziger Jahren
Denn es war gekommen, was viele befürchtet und nicht wenige erhofft hatten: der Krieg.
Und als am 3. Sep-tember Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg erklärten, konnte sich das Volk vor lauter Glück kaum beherrschen: Die Stimmung war – und nicht nur in Warschau – enthusiastisch.
So sicher ich war, daß der Krieg mit der Niederlage Hitlers und der Seinen enden werde, so sehr befürch-tete ich – und sagte es meinen Freunden damals immer wieder –, daß den Juden Grausames bevorstehe.
Daß es so enorm war, daß es in Polen Gegenden gab, in denen die Menschen nicht anders lebten als im Mittelalter, das habe ich erst im September 1939 erfahren.
Sie waren, wie ein nicht geringer Teil des polnischen Volkes, Analphabeten.
Heute, nur heute, Bin ich so schön; Morgen, ach morgen Muß Alles vergehn! Das Vergänglichkeitsmotiv, ganz einfach, scheinbar kunstlos ausgedrückt, hatte diese Achtzehnjährige beeindruckt. Das verwunderte mich nicht, denn ich wußte aus eigener Erfahrung, daß für dieses Motiv besonders empfänglich jene Menschen sind, die es gerade entdeckt hatten.
Nach dem blitzschnellen, dem großartigen Triumph bot sich den ausgelassenen und begreiflicherweise abenteuer-lustigen deutschen Soldaten auf den Straßen einiger Viertel der polnischen Hauptstadt ein überraschender Anblick.
Gewiß, auch von ihnen, doch häufiger noch von jenen, die ihnen, den neuen Herrn, sofort zu Diensten standen: von polnischen Rowdies und Nichtstuern aller Art, oft von Halbwüchsigen, die glücklich waren, daß sie eine fröhliche und auch abwechslungsreiche Betätigung gefunden hatten.
Anders als am Rhein oder Main konnten sie endlich tun, wovon sie immer schon geträumt hatten: die Sau rauslassen.
Ich meinte, es sei richtiger, diesen grausamen Zirkus schweigend, brüllend und singend mitzumachen, als den Tod zu riskieren.
Den Deutschen, die sich diese Späße leisteten, verdarb niemand das Vergnügen, niemand hinderte sie, die Juden zu mißhandeln und zu morden, niemand zog sie zur Verantwortung. Es zeigte sich, wozu Menschen fähig sind, wenn ihnen unbegrenzte Macht über andere Menschen eingeräumt wird.
Noch hatten wir nicht begriffen, daß dort, wo sich zur Barbarei und zur Grausamkeit Zufall und Willkür gesellen, die Frage nach Sinn und Logik weltfremd und müßig ist. Der
Alle Rundfunkapparate hatten wir schon im Oktober 1939 abliefern müssen. Also war man auf die von Mund zu Mund gehenden Nachrichten angewiesen, die nicht immer zutrafen, und auf die sich unentwegt verbreitenden Gerüchte, die nicht immer falsch waren.
»Wer am meisten liebt, ist der Unterlegene und muß leiden« – diese schlichte und harte Lehre aus dem »Tonio Kröger« hatte sich mir, als ich die Liebe nur aus der Literatur kannte, fest eingeprägt.
Dennoch war sein Selbstbewußtsein nicht stark ausge-prägt – und vielleicht hing sein Tod damit zusammen.
Die Endlösung war noch nicht beschlossen, ja man kannte dieses Wort noch nicht.
Damals konnte ich nicht wissen, daß sich diese Situation in meinem beruflichen Leben noch mehrfach wiederholen sollte: Immer wieder sah ich mich vor Aufgaben gestellt, für die ich nicht im geringsten vorbereitet war.
So begann ich als ein Autodidakt – und ich bin ein Autodidakt geblieben. Nach meinem Abitur hat sich nie jemand bemüht, mir etwas beizubringen. Was ich kann, habe ich selber gelernt.
jüdischen Miliz, die »Jüdischer Ordnungsdienst«
war aus dem »Seuchensperrgebiet«, aus dem offiziell »der jüdische Wohnbezirk« genannten Stadtteil ein riesiges Konzentrationslager geworden: das Warschauer Getto.
also der (sehr unbeliebten) jüdischen Miliz.
Es waren Menschen, die das Risiko einkalkulierten und den Tod offenbar nicht fürchteten.
Im Getto existierten, wer hätte das gedacht, auch Taxis, aber keine Autos und keine Pferdedroschken, sondern Rikschas. Das waren Fahrräder, auf denen findige Leute, in der Regel junge Techniker, einen breiten Sitz montiert hatten; er reichte für zwei Personen.
Das ist wörtlich gemeint: Am Straßenrand lagen, vor allem in den Morgenstunden, die mit alten Zeitungen nur dürftig bedeckten Leichen jener, die an Entkräftung oder Hunger oder Typhus gestorben waren und für deren Beerdigung niemand die Kosten tragen wollte.
Zum Straßenbild im Getto gehörten unzählige Bettler, die, an eine Hauswand gelehnt, auf der Erde saßen und laut jammernd um ein Stück Brot baten; ihr Zustand ließ vermuten, daß sie sehr bald nicht mehr sitzen, sondern liegen würden – von Zeitungen bedeckt.
Natürlich wurde im Getto gestohlen, doch gab es keinen einzigen Mordfall – wohl aber einen Fall von Kannibalismus: Eine dreißig Jahre alte Frau, die vor Hunger dem Wahnsinn verfallen war, hat aus der Leiche ihres zwölfjährigen Sohnes einen Gesäßteil herausgeschnitten und zu verspeisen versucht. Als ich den Bericht hierüber ins Deutsche übersetzte, wurde ich darauf hingewiesen, daß diese Sache geheimgehalten werden müsse.
Auch Sexualszenen hat man gedreht: Mit der Pistole in der Hand zwangen deutsche Dokumentarfilmer junge Männer, mit älteren und nicht gerade ansehnlichen Frauen zu koitieren und junge Mädchen mit alten Männern. Diese Filme, die man zum Teil nach dem Krieg in Berliner Archiven gefunden hat, wurden aber nicht öffentlich vorgeführt: Das Propagandaministerium und andere deutsche Instanzen sollen befürchtet haben, die Aufnahmen könnten statt Ekel Mitleid hervorrufen.
Das alles hat sich nach 1939 nicht geändert, es gab also in Warschau nach wie vor zwei getrennte jüdische Welten. Auch ich kannte im Getto Menschen aus dem jiddischen Milieu überhaupt nicht.
Übrigens kann ich mich nicht beschweren: Nie im Leben hat mich meine berufliche Arbeit gelangweilt.
Ein stiller, unermüdlicher Organisator war er, ein kühler Historiker, ein leidenschaftlicher Archivar, ein erstaunlich beherrschter und zielbewußter Mann.
Die Juden im Warschauer Getto wurden gemartert. Ihnen ist Grauenhaftes widerfahren. Aber bisweilen auch Schönes und Wunderbares. Sie haben gelitten. Aber sie haben auch geliebt.
Und die übliche Angst, die häufig, ob im Frieden oder im Krieg, das Zusammenleben junger Leute erschwerte, an der sie jedenfalls litten, die Angst vor der Schwangerschaft?
Goethe und Heine.
Serenade in C-Dur von Tschaikowsky.
Wenige Monate nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Warschau lassen die deutschen Behörden das Denkmal Frederic Chopins sprengen.
Der Kritiker, Wiktor Hart, bewunderte Marysia Ajzensztadt. Ihr Gesang – schrieb er – »zeugt von höchster Kunst, von Maß und Einfachheit, sie hat es in kürzester Zeit zu wahrer Meisterschaft gebracht«. Wer war dieser enthusiastische Wiktor Hart? Wenn heute sein Name in zeitgeschichtlichen Büchern auftaucht, dann steht in Klammern ein Fragezeichen oder es heißt: »nicht ermittelt«. Doch zwischen uns sei Wahrheit: Ich war es.