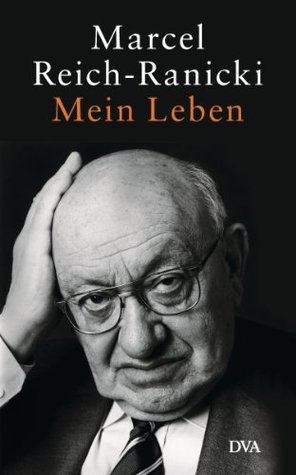Kindle Notes & Highlights
Wie man sieht, waren offene antisemitische Äußerungen im Unterricht nicht üblich – jedenfalls nicht in dieser Schule oder zumindest nicht in unserer Klasse.
Beiläufig wurde ich – mit ernster Miene freilich – gefragt, wie ich denn den Krieg überstanden hätte. Es gehörte sich doch, meinten wohl meine Schulfreunde, ein gewisses Interesse zu zeigen. Eine Höflichkeitsfrage war es, nicht mehr. Ich antwortete kurz und bündig. Niemand wollte Genaueres hören. Man war mir dankbar, daß ich rasch das Thema wechselte. Alle diese Herrn, gebildete und nachdenkliche Menschen, waren Offiziere der Wehrmacht gewesen, im Osten und im Westen. Man kann sicher sein: Sie haben Schreckliches und Grausames miterlebt. Hatten sie auch mit Judenverfolgungen zu tun? Ich weiß
...more
Daß sich keiner mitschuldig fühlte, kann ich wohl verstehen. Nichts liegt mir ferner, als ihnen eine Mitschuld zuzuschreiben. Aber eine gewisse Mitverantwortung dafür, was Deutsche getan hatten, was im deutschen Namen geschehen war? Nein, auch von Mitverantwortung war nichts zu hören, sie wollten nicht darüber reden. Meine wohlerzogenen Schulfreunde, die einst braune und schwarze Uniformen getragen hatten und später jene der Wehrmacht – sie waren, glaube ich, typische Vertreter der Jahrgänge 1919 und 1920. Ich hatte nicht die Absicht, auf dem Thema zu bestehen. Wir waren ja nicht nach Berlin
...more
Ich hätte mich, sagte ich, im Laufe des vergangenen Vierteljahrhunderts oft gefragt, warum sich die Mitschüler uns Juden gegenüber damals, im »Dritten Reich«, trotz der ungeheuerlichen antisemitischen Propaganda nichts hätten zuschulden kommen lassen. Eine Weile schwiegen alle. Schließlich sagte einer der Anwesenden, eher zögernd: »Herrgott, wie sollten wir denn an die Theorie von der Minderwertigkeit der Juden glauben? Der beste Deutschschüler der Klasse war ein Jude und einer der schnellsten Hundertmeterläufer ebenfalls ein Jude.« Ich war verblüfft, diese Antwort enttäuschte mich, ich fand
...more
This highlight has been truncated due to consecutive passage length restrictions.
Ja, das trifft die Sache: Millionen haben weggesehen.
Schiller
Liebe zu einem Gebäude,
Sie emigrierte 1933 und hat sich dann in den Vereinigten Staaten das Leben genommen.
Damals habe ich zweierlei gelernt – erstens, daß man in der Literaturbetrachtung auch etwas riskieren müsse und, zweitens, daß man sich von Klassikern nicht einschüchtern lassen solle.
»Ich kann die Klassiker nicht leiden, die Schule hat sie mir verekelt« – man hört dies oft. Für mich gilt das nicht, es war ja gerade umgekehrt: Die Schule hat, wie sonst nur noch das Theater, mein Interesse für die Literatur von Lessing bis Gerhart Hauptmann, zumal für Goethe, Schiller und Kleist, in hohem Maße gesteigert und bisweilen meine Begeisterung auch auf mir noch unbekannte Bereiche gelenkt.
Anders der Liberale, Carl Beck. Dieser joviale, gutmü-tige Mensch gehörte gewiß zu jenen, die Lehrer wurden, weil es ihnen nicht gelingen wollte, ihre beruflichen Vorstellungen zu verwirklichen.
Heine.
Er war bei fast allen Schülern unbeliebt. Warum? Wegen der Zugehörigkeit zur NSDAP? Nein, natürlich nicht, sondern weil er sich damit brüstete. Das weckte Mißtrauen. Opportunisten mochte man nicht.
Beschämt gebe ich zu, daß ich enttäuscht und tatsächlich erbost war. Die Entscheidung des »Goldfasans« war kleinlich, aber meine Reaktion darauf lächerlich.
Ich vermag es heute nicht mehr zu erklären, wie ich es schaffen konnte, innerhalb von fünf, sechs Jahren alle Dramen von Schiller und die meisten von Shakespeare zu lesen, nahezu alles von Kleist und Büchner, sämtliche Novellen von Gottfried Keller und Theodor Storm, einige der großen und meist umfangreichen Ro-mane von Tolstoj und Dostojewski, von Balzac, Stendhal und Flaubert.
Und wenn mir der Text mißfällt? Dann langweile ich mich, kann mich nicht recht konzentrieren und merke plötzlich, daß ich eine ganze Seite kaum verstanden habe und sie noch einmal lesen muß. Ob gut oder schlecht – es geht nur langsam voran.
Thomas, Heinrich und Klaus Mann,
Joseph Roth,
Allerdings fällt mir auf, daß ich damals einen Namen von höchster Bedeutung überhaupt nicht gehört hatte: Franz Kafka.
Frank Auerbach.
Was er mir in langen Gesprächen erzählte, zeigte mir, daß das Unterhaltsame belehrend sein kann und daß das Belehrende nicht aufdringlich sein muß.
Er befürchtete, daß ich, der ich damals fünfzehn, sechzehn Jahre alt war, von der Literatur bezaubert, das Leben vernachlässigen könne. Mehr als einmal berief er sich auf den alten Spruch »Primum vivere, deinde philosophari« (»Zuerst leben, dann erst philosophieren«). Er sah bei mir die Gefahr, das Intellektuelle könne alles andere verdrängen.
Schriftsteller im Exil: von Thomas Mann
Ins Kino ging ich seltener, mein Interesse für die Filmkunst hielt sich schon damals in Grenzen
Eines meiner aufregendsten Filmerlebnisse war Willi Forsts »Maskerade« mit Paula Wessely.
regte mich auch an,
In meinem ganzen Leben hat mich keine Schauspielerin so nachhaltig beeindruckt wie Käthe Gold
Zu den Shakespeare-Dramen, die ich schon kannte, gehörte »Romeo und Julia« nicht.
Daß mir ein Erlebnis bevorstand, so herrlich wie schrecklich: zu lieben, ohne auch nur für einen Augenblick die höchste Todesgefahr vergessen zu können, und also lie-bend die Nähe des Todes zu ertragen.
Auf der Bühne habe ich den »Hamlet« mindestens zehnmal gesehen – in vier Sprachen (deutsch, englisch, französisch und polnisch)
So habe ich allen Versuchungen widerstanden und nie auch nur den kleinsten Aufsatz über den »Hamlet« verfaßt; ich habe es nicht gewagt.
Regisseurs Gründgens,
Um die ihrer Ansicht nach dekadente Großstadtkultur, um das, was sie für verdorben, verächtlich und verwerflich hielten, zu charakterisieren, haben sich die Nationalsozialisten oft der Vokabel »Asphalt« bedient: Sie sprachen von der »Asphaltpresse«, der »Asphaltkultur« und, am häufigsten, von den »Asphaltliteraten«. Obwohl es Goebbels war, der diesen Begriff wenn nicht erfunden, so gewiß popula-risiert hat, habe ich ihn gern, er gefällt mir: Sollte mich jemand heute als einen »Asphaltliteraten« bezeichnen, es würde mich nicht beleidigen, sondern freuen.
Ich hielt ihn für den Antityp der Zeit. Nicht Blut und Boden verkörperte er, wohl aber das Morbide und das Anrüchige, das Zwielich-tige. Nicht die Helden spielte er und auch nicht die Gläubigen, sondern die Gebrochenen und die Degenerierten, die Schillernden.
Seine Kunstauffassung, seine antiheroische Haltung, seine Vorliebe für die Zweifler, die Ironiker und die Skeptiker – das alles war genau das Gegenteil von dem, was die Nazis anstrebten, was sie lauthals verkündeten.
Mephisto in beiden Teilen des »Faust«.
Es wurde schon oft gesagt, daß jede Generation im »Hamlet« sich selber gesucht und gefunden hat, die eigenen Fragen und Schwierigkeiten, die eigenen Niederlagen.
In diesem Königreich Dänemark, einem Polizeistaat, werden alle von allen ausspioniert:
Nachdem ich Gründgens gesehen hatte, habe ich jede Szene des »Hamlet« anders gelesen als zuvor – vor allem als Tragödie des Intellektuellen inmitten einer grausamen Gesellschaft und eines verbrecherischen Staates.
»Tristan und Isolde«.
Ich bin schon einverstanden, aber dieser furchtbare Wagner, er hat doch«, jetzt kam ich mit meinem Joker, »er hat doch den ›Tristan‹ geschrieben.«
»Wie stehen Sie eigentlich, lieber Herr Stockhausen, zu Wagner?« Er antwortete gelangweilt, er habe unlängst wieder einmal die »Walküre« gehört und auch den »Lohengrin«. Das sei ganz und gar indiskutable Musik.
Nur sollte ich noch sagen, welches Buch mir zu den frühen Einsichten in das Sexuelle und den elementaren in das Literarische verholfen hat. Es war der Roman »Narziß und Goldmund« von Hermann Hesse.
Ich begriff, daß sich in der Literatur etwas finden und erkennen ließe, dessen Bedeutung nicht zu überschätzen sei – man könne sich selber finden, seine eigenen Gefühle und Gedanken, Hoffnungen und Hemmungen.
Alfred Döblin, der seine Jugend freilich noch im neunzehnten Jahrhundert erduldet und erlitten hat, berichtet, er habe eine nackte Frau zum ersten Mal als Student der Medizin im Alter von 23 Jahren gesehen – es war eine weibliche Leiche im Anatomiesaal.
Diese Garderobe ging wahrscheinlich auf das Vorbild jener Schauspielerin zurück, die eine ganze Generation von Männern und Frauen fasziniert hatte, deren Name aber jetzt, in den Jahren des »Dritten Reichs«, nicht mehr öffentlich genannt werden durfte – auf das Vorbild Marlene Dietrichs.
»Liebe nennen wir jenes extreme Gefühl, das von der Zuneigung zur Leidenschaft führt und von der Leidenschaft zur Abhängigkeit; es versetzt das Individuum in einen rauschhaften Zustand, der zeitweise die Zurechnungsfähigkeit des Betroffenen, des Getroffenen einzuschränken vermag: Ein Glück ist es, das Leiden bereitet, und ein Leiden, das den Menschen beglückt.«
Daß das Erzählen über sich selber eine unerhörte Gabe sein kann, eine solche, die der Hingabe gleichkommt oder sich nähert – ich erlebte es zum ersten Mal.
Ich begann zu begreifen, daß Liebe immer auch mit dem Bedürfnis nach Selbstbestätigung zu tun hat und daß es keine Liebe ohne Dankbarkeit gibt.
Sie muß nicht aus Dankbarkeit entstehen, aber sie führt zu ihr – oder erlischt.