Karin Taglang's Blog, page 2
November 27, 2017
Rezension: Das Leben ist gut
„Man lasse sich von der Vitalität dieses Buches anstecken. Gleich lebt es sich besser“, schrieb Beatrice Eichmann-Leutenegger in der Neuen Zürcher Zeitung. Treffender könnte ich den neusten Roman vom Schweizer Autor Alex Capus nicht beschreiben.
Das Leben ist gut ist eine völlig alltägliche Geschichte. Über die gesamte Zeitspanne hinweg passiert fast nichts – und doch steckt so viel Liebe und Lebensfreude darin.
Die Freuden und Leiden des Alltags
Genauer erzählt Capus in Das Leben ist gut aus dem Leben von Max und Tina. Die beiden sind seit 25 Jahren verheiratet und leben ihren völlig gewöhnlichen Alltag zusammen mit ihren Kindern, bis Tina wegen der Arbeit für ein Jahr nach Paris geht.
Es ist das erste Mal seit Jahren, dass die beiden getrennt sein werden. Die Geschichte beginnt am letzten Abend vor Tinas Abreise. Auf diesen allerersten Seiten versteckt sich direkt eine der schönsten Passagen des Romans:
„Jemand wird für dich die Glühbirnen auswechseln müssen. Wer soll das tun, wenn ich nicht da bin?“, sorgt sich Max. „Ich werde im Hotel wohnen“, antwortet Tina. „Auch in Hotels wechselt man Glühbirnen.“
Diese banale Diskussion geht weiter, bis Tina schliesslich verspricht, sich von niemandem die Glühbirnen wechseln zu lassen und stattdessen ihren Mann anzurufen, falls eine kaputtgeht.
Tina reist also ab und Max bleibt zurück, allein mit seinen Kindern und seiner Bar, der „Sevilla-Bar“. Und dann passiert erst einmal nichts. Das Leben geht weiter.
Ein Erzähler mit Herz
Am Anfang habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass Tina am ersten Wochenende nach Hause kommt. Aber wie gesagt, erstmal bleibt (fast) alles beim Alten. Max lebt sein Leben weiter, geht auch ohne Tina das Altglas von der Bar entsorgen und bewirtet die gleiche Stammkundschaft wie jeden Tag.
Und das ist der ganze Zauber von Das Leben ist gut. Man schliesst den Erzähler Max sofort ins Herz. Der leidenschaftliche Barkeeper mag Gewohnheiten und Routine. Friedlich und ganz gemütlich geht er durchs Leben und öffnet uns Leser*innen die Augen für die kleinen Freuden im Alltag.
In unserer gestressten Welt, wo wir alle immer noch mehr machen und noch schneller sein wollen, ist das ruhige Leben von Max einfach nur erfrischend. Er liebt das Leben und er liebt seine Frau – was will man mehr?
Ein ganz gemütliches Buch
Wenn ich Das Leben ist gut mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre dieses Wort „gemütlich“. Es passiert nicht viel, man braucht sich also von der Handlung nicht gestresst zu fühlen. Und trotzdem wird es nie langweilig.
Capus‘ Stil ist angenehm leicht zu lesen und besonders seine Hauptfigur Max ist ihm sehr gut gelungen. Alex Capus hat mit Max einen wundervollen Ich-Erzähler geschaffen, der uns mitnimmt in sein entspanntes, einfaches Leben.
Max ist zufrieden. Und so hat Das Leben ist gut hat auch mich zufriedener gemacht, denn das Leben ist gut.
Das Leben ist gut kaufen
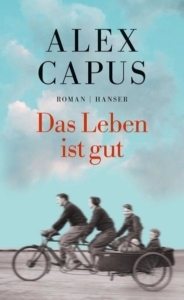 Das Leben ist gut von Alex Capus ist 2016 bei Hanser erschienen.
Das Leben ist gut von Alex Capus ist 2016 bei Hanser erschienen.
Erscheinungsdatum: 22.08.2016
Seitenzahl: 240
Bei Orell Füssli kaufen: Fr. 14.90
Du möchtest mehr von mir hören?
Dann abonnieren den TZR-Newsletter! Er informiert dich über alle neuen Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag Rezension: Das Leben ist gut erschien zuerst auf The Zurich Review.
November 17, 2017
Intersexualität – was ist das?
Kürzlich habe ich ein Buch mit einer intersexuellen Protagonistin gelesen. Dabei wurde mir bewusst, dass viele Menschen – mich eingeschlossen – keine Ahnung haben, was das überhaupt heisst. Dabei werden z. B. in Deutschland jährlich schätzungsweise 150 intersexuelle Kinder geboren (1), und deshalb möchte euch hier das Thema Intersexualität näherbringen.
Für Kristin Lattimer aus None of the Above ist nicht ihre Diagnose, sondern die Unwissenheit ihres Umfelds das grösse Problem. Ihre Mitschüler*innen mobben sie und nennen sie eine „schwule Transe“, doch sie wissen nicht, wovon sie sprechen. In meiner Rezension gehe ich vertieft auf das Buch ein, doch hier möchte ich jetzt nicht mehr Zeit verschwenden …
… also her mit den Definitionen!
Okay, wie du willst:
Als Intersexualität bezeichnet man angeborene Abweichungen von der üblichen männlichen oder weiblichen Entwicklung der Gonaden (Keimdrüsen) und/oder der geschlechtsspezifischen Differenzierung des inneren und äusseren Genitales. (2)
Jetzt weisst du viel mehr, oder? Ganz simpel gesagt heisst das, ein Mensch ist intersexuell (‚zwischen‘ den Geschlechtern), wenn er aufgrund seiner körperlichen und genetischen Merkmale nicht eindeutig dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden kann.
Dabei muss man sich bewusst sein, dass das Wort „intersexuell“ absolut nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun hat (wie bei homosexuell, pansexuell, etc.), sondern sich nur auf das biologische Geschlecht bezieht. Eine intersexuelle Person kann also gleichzeitig auch zum Beispiel lesbisch sein, wenn sie sich als Frau identifiziert.
Und was ist mit Transsexualität?
Intersexualität wird häufig mit Transsexualität verwechselt, so auch bei Kristin Lattimer aus None of the Above. Ihr Umfeld glaubt zunächst, sie sei eine Frau im Körper eines Mannes und alle gehen davon aus, dass sie irgendwo einen Penis versteckt – dabei könnte ihr Äusserliches, einschliesslich ihrer Genitalien, weiblicher nicht aussehen.
Bei Intersexualität handelt es sich um einen medizinischen Zustand, während Transsexualität ein Phänomen von psychischer Natur ist. Transsexuelle Menschen haben das Gefühl, im „falschen“ Körper geboren zu sein und fühlen sich stattdessen dem anderen Geschlecht zugehörig.
Rein biologisch gesehen ist der Körper bei transsexuellen Menschen in der Regel jedoch eindeutig als männlich oder weiblich zu erkennen. Bei ihnen ist es die Geschlechtsidentität, die nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt.
Die Gesellschaft will Schubladen
In unserer Gesellschaft wissen leider viele Menschen kaum etwas über Intersexualität. So entstehen für die Betroffenen teilweise grosse Probleme, zum Beispiel bei Sportwettkämpfen:
Im Jahr 2009 hat die Leichtathletin Caster Semenya unfreiwillig negative Schlagzeilen gemacht, nachdem sie an den Weltmeisterschaften in Berlin eine Goldmedaille gewonnen hatte. Ihre Mitstreiterinnen beschuldigten sie, ein Mann zu sein, bis herauskam, dass sie intersexuell ist. (Quelle: LA Times)
Doch auch ganz alltägliche Dinge, wie zum Beispiel das Ausfüllen eines Formulars, können intersexuelle Menschen in Schwierigkeiten bringen. Welches Geschlecht soll man denn nun wählen, wenn es nur „männlich“ oder „weiblich“ zur Auswahl gibt? Das, mit dem man sich eher identifiziert oder das, was man biologisch eher ist? Und was, wenn man wirklich „zwischen“ den Geschlechtern ist?
Das „dritte“ Geschlecht
Erst kürzlich, am 8. November 2017, entschied der Gerichtshof in Karlsruhe, dass es im deutschen Recht künftig ein „drittes“ Geschlecht geben muss. Die Richter begründeten ihren Entscheid damit, dass sonst eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts und des Diskriminierungsverbots vorliege. (Quelle: Berliner Morgenpost)
Wie dieses „dritte“ Geschlecht heissen soll, hat das Gericht nicht vorgegeben. Denkbar wären Begriffe wie „inter“ oder „divers“ – letzterer wäre auch für transsexuelle oder andere Menschen mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität eine gute Möglichkeit.
Braucht es überhaupt noch Geschlechter?
In unserer heteronormativen Gesellschaft ist die Trennung zwischen Mann und Frau, männlich und weiblich, tief verankert. Der allergrösste Teil aller Kinder wird als „Junge“ oder als „Mädchen“ erzogen; von klein auf lernen wir, wie wir uns als Frauen oder Männer zu verhalten haben, was wir anziehen sollen und womit wir spielen dürfen.
Solche gesellschaftlichen Werte und Normen lassen sich nicht von heute auf morgen zerschlagen. Dennoch ist es auf dem Weg zur wahren Gleichstellung wichtig, dass wir versuchen, ausserhalb der gewohnten Mann-Frau-Dichotomie zu denken. Die intersexuellen Menschen werden es uns danken.
Literatur:
Richter-Appelt, H. 2013. „Intersexualität nicht Transsexualität. Abgrenzung, aktuelle Erkenntnisse und Reformvorschläge.“ In: Bundesgesundheitsblatt 2013, S. 240-249. https://www.springermedizin.de/intersexualitaet-nicht-transsexualitaet/8012524.
Holterhus, P.-M.“Intersexualität und Differences of Sex Development (DSD). Grundlagen, Diagnostik und Betreuungsansätze.“ In: Bundesgesundheitsblatt 2013, S. 1686-1694. https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1850-y.
Du möchtest mehr von mir hören?
Dann abonnieren den TZR-Newsletter! Er informiert dich über alle neuen Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag Intersexualität – was ist das? erschien zuerst auf The Zurich Review.
November 10, 2017
Rezension: The Girl on the Train
Ich pendle jeden Morgen mit dem Zug von Zürich nach Bern. Diese Zeit verbringe ich am liebsten mit einem guten Buch. Als ich kürzlich The Girl on the Train von Paula Hawkins ausgepackt habe, schmunzelte der Mann gegenüber. „Dieses Buch muss man ja fast im Zug lesen“, meinte er. In diesem Moment wurde mir bewusst: Die Protagonistin Rachel – das Mädchen im Zug – und ich haben einiges gemeinsam.
Zumindest sitzen wir beide fast jeden Tag im gleichen Zug, auf dem gleichen Platz. Während ich jedoch immerzu in ein Buch starre, blickt Rachel aus dem Fenster und beobachtet die Leute, die in Gleisnähe wohnen. Am liebsten schaut sie bei Jess und Jason (in Wirklichkeit heissen sie Megan und Scott) auf die Terrasse, denn in Rachels Augen sind die beiden das perfekte Paar. Rachel selbst hatte nicht so viel Glück im Leben: Sie ist geschieden und seither tief in den Alkoholismus abgerutscht.
Rachel, die unzuverlässige Erzählerin
An einem Morgen wie jedem anderen sieht Rachel etwas Ungewöhnliches auf der Terrasse von Megan und Scott. Kurz darauf verschwindet Megan spurlos. Zunächst fällt der Verdacht auf ihren Ehemann, doch Rachel ist sich sicher, dass er ihr nichts angetan hat. Schliesslich ist Scott doch der perfekte Mann. Aber wer glaubt schon einer verwahrlosten, geschiedenen Alkoholikerin? Die Polizei jedenfalls nicht, und ich als Leserin irgendwie auch nicht.
Doch Rachel gibt nicht auf. Sie weiss, dass sie selbst in jener Nacht, als Megan verschwand, in der Nähe ihres Hauses war. Dumm nur, dass sie ein Blackout hat – sie hat wiedermal zu viel getrunken. Das Einzige, woran sie sich erinnert, ist diese kurze Episode:
I could see myself a few metres in, slumped against the wall, my head in my hands, and both head and hands smeared with blood. (1)
Doch nach und nach kehrt die Erinnerung zurück, bis ihr schliesslich klar wird, wer für Megans Verschwinden verantwortlich ist …
Drei Frauen, drei Perspektiven
Die Geschichte um Megans Verschwinden wird aus der Perspektive dreier Frauen erzählt: Rachel, the girl on the train, Megan, die verschwunden ist, und Anna, die neue Frau von Rachels Ex-Mann Tom, die nur ein paar Häuser von Megan und Scott entfernt wohnt.
Keine der drei Frauen ist besonders sympathisch, sie alle sind egoistisch und auf verschiedene Arten unfreundlich. Rachel ist zude Alkoholikerin und wäre wohl schon längst auf der Strasse gelandet, wenn sie ihre Freundin Cathy nicht bei sich aufgenommen hätte.
Die Perspektiven von Rachel und Megan sind nötig, um die Geschichte zu erzählen. Jene von Anna hingegen hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Sie trägt nicht viel zur Geschichte bei, ausser, dass sie uns Einblick bietet in Rachels früheres Leben mit ihrem damaligen Ehemann Tom.
Der grösste Teil der Geschichte wird jedoch von Rachel erzählt, was mir persönlich auch ganz recht ist. Rachel hat zwar viele Fehler und sicher schon einiges falsch gemacht im Leben, doch die Sache mit Megan scheint sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Sie meint es gut und will nur helfen – auch wenn sie manchmal eher das Gegenteil tut.
Ein Psycho-Thriller mit Herz
Paula Hawkins bedient sich in The Girl on the Train einer einfachen Sprache, die angenehm zu lesen ist und gut zu den Erzählerinnen passt. Die Geschichte reisst einen mit, hinein in die verdrehte Welt von Rachel, und die Handlung geht schnell voran, wie es sich für einen guten Thriller gehört.
Dennoch ist The Girl on the Train mehr als ein Thriller, denn Hawkins begibt sich tief in die Gefühlswelt ihrer drei Erzählerinnen. Eine schöne Abwechslung in der Thriller-Welt, finde ich.
Übersetzungen
Die Zitate wurden für diesen Artikel von mir selbst übersetzt, es handelt sich daher nicht um die offizielle Übersetzung des Buches.
Ich hatte mich selbst vor Augen: ein paar Meter weiter vorne, zusammengesackt gegen die Wand gelehnt, den Kopf in meinen Händen. Mein Kopf und meine Hände waren blutverschmiert.
The Girl on the Train kaufen
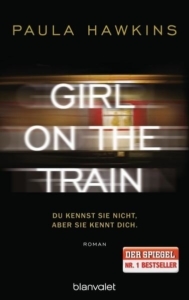 Die deutsche Version von The Girl on the Train ist 2015 bei Blanvalet erschienen.
Die deutsche Version von The Girl on the Train ist 2015 bei Blanvalet erschienen.
Erscheinungsdatum: 15.06.2015
Seitenzahl: 448
Bei Orell Füssli kaufen: Fr. 14.90
Du möchtest mehr von mir hören?
Dann abonnieren den TZR-Newsletter! Er informiert dich über alle neuen Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag Rezension: The Girl on the Train erschien zuerst auf The Zurich Review.
November 3, 2017
Rezension: None of the Above
Kristin Lattimer ist eine ganz normale Highschool-Schülerin: Sie ist 18 Jahre alt, hat einen Freund, ist sportlich aktiv und gerne mit ihren Freundinnen unterwegs. Das klingt erst einmal langweilig, bis Kristin – genannt Krissy – bei ihrem ersten Mal so starke Schmerzen hat, dass sie zum Frauenarzt geht. Dort kommt heraus: Kristin ist intersexuell.
Was das heisst? Krissy selbst versteht von ihrer Diagnose erstmal nicht viel. Ihre erste Vorstellung davon ist:
I was a car that came off the assembly line all messed up. I was a lemon. (1)
Offiziell bedeutet „intersexuell“, dass eine Person biologisch nicht eindeutig dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden kann, sie befindet sich „zwischen“ (‚inter‘) den Geschlechtern. Bei der Multiple-Choice-Frage „Geschlecht“ wäre Krissy also nicht männlich und auch nicht weiblich, sondern „None of the Above“.
So lautet auch der Titel von I. W. Gregorios Debüt. Der Young-Adult-Roman None of the Above ist 2015 bei Balzer + Bray (Harper Collins) erschienen und erzählt die Geschichte von Kristin Lattimer. Die Autorin lebt in Pennsylvania, USA und ist Chirurgin. Der Roman hat daher einen fundierten medizinischen Hintergrund.
Coming-of-Age mal anders
None of the Above ist keine alltägliche Coming-of-Age-Geschichte; schliesslich ist Intersexualität auch kein alltägliches Thema. Deshalb herrscht viel Unwissenheit und niemand weiss so recht, was Intersexualität überhaupt ist. So geht es auch Krissy. In ihrer Verzweiflung erzählt sie ihren zwei besten Freundinnen davon und, wie es in High Schools halt so ist, weiss innert kürzester Zeit die ganze Schule davon.
Für Krissy heisst das, dass sie nicht nur selbst mit ihrer Diagnose klarkommen muss, sondern sie muss auch mit den heftigen Reaktionen aus ihrem Umfeld umzugehen lernen. Sie wird zum Opfer von offenen Anfeindungen, Cyber-Mobbing und erlebt sogar ein Hate Crime. Einige nennen sie „Hermaphrodit“; ihr eigener Freund beschimpft sie als „tranny faggot“.
Viele Leute in ihrem Umfeld stellen sich unter „intersexuell“ einen Körper mit Brüsten und einem Penis vor. Dabei äussert sich die Intersexualität bei Krissy ganz anders: Ihre exakte Diagnose lautet Androgeninsensitivität.
Menschen mit diesem Syndrom haben XY-Chromosome, was eigentlich typisch für Männer ist. Deshalb entwickeln sie als Fötus normale Hoden, die Androgene ausschütten. Doch der Körper kann diese aufgrund der Insensitivität nicht verarbeiten, weshalb sich der Rest, bzw. das Äussere des Körpers, weiblich entwickelt. Krissy hat also äusserlich einen komplett weiblichen Körper (abgesehen von einer verkürzten Vagina), innerlich hat sie jedoch Hoden anstatt einer Gebärmutter.
Das Problem ist die Unwissenheit
I hate it that people don’t understand what intersex is. That they think that I’m some sort of transsexual. (2)
Hinter Homophobie und Rassismus steckt bei den meisten Menschen die Angst vor dem Unbekannten. Intersexualität ist ein Thema, über das die wenigsten von uns informiert sind, und deshalb ist das Stigma so gross. Mit None of the Above hat I. W. Gregorio einen enorm wichtigen Beitrag zur Beseitigung dieses Stigmas geleistet.
Dank ihrer Tätigkeit als Chirurgin kann die Autorin die medizinischen Hintergründe von Intersexualität, Androgeninsensitivität im Speziellen, korrekt und detailliert wiedergeben – und zwar so, dass man es auch als Laie versteht. Je mehr man über intersexuelle Menschen hört und liest, desto kleiner wird das Stigma. Denn wer weiss, worum es geht, kann einem intersexuellen Menschen Verständnis und Liebe statt Hass entgegenbringen.
Darüber hinaus wirft None of the Above noch tiefere gesellschaftliche Fragen auf. Intersexualität fordert die klassische Vorstellung von „männlich“ und „weiblich“ heraus. Ist Krissy weniger Frau als ihre Freundinnen Vee und Faith? Und was heisst das überhaupt – eine Frau zu sein?
Weil die Thematik in diesem Buch von so grosser Bedeutung ist, habe ich None of the Above mit vier von fünf Sternen bewertet. Die Handlung ist an einzelnen Stellen vielleicht nicht besonders gut ausgearbeitet, doch Gregorios direkter und ungeschmückter Stil hat mir gefallen. Schliesslich ist der Roman aus der Ich-Perspektive von Krissy geschrieben, und alles andere hätte nicht zu ihr gepasst.
Alles in allem ist None of the Above ein wichtiges und spannendes Jugendbuch, von dem auch Erwachsene noch viel lernen können.
Übersetzungen
Die Zitate wurden für diesen Artikel von mir selbst übersetzt, es handelt sich daher nicht um die offizielle Übersetzung des Romans.
Ich bin ein Auto, das in der falschen Reihenfolge zusammengesetzt wurde. Ich bin eine Zitrone.
Ich hasse es, dass die Leute nicht verstehen, was Intersexualität ist; dass sie denken, ich sei irgendwie transsexuell.
None of the Above kaufen
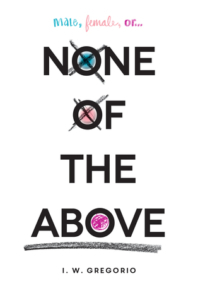 None of the Above ist 2015 bei Balzer + Bray (Harper Collins) erschienen.
None of the Above ist 2015 bei Balzer + Bray (Harper Collins) erschienen.
Erscheinungsdatum: 07.04.2015, 352 Seiten
Bei Orell Füssli kaufen: Fr. 13.90
Du möchtest mehr von mir hören?
Dann abonnieren den TZR-Newsletter! Er informiert dich über alle neuen Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag Rezension: None of the Above erschien zuerst auf The Zurich Review.
November 1, 2017
To Be Read: November 2017
Im November ist immer schrecklich viel los: Im Büro gibt’s viel zu tun, was noch dieses Jahr erledigt werden muss, Mitte Monat gilt es, an den deutschen Meisterschaften im Irish Dance meinen Titel zu verteidigen und dann habe ich auch noch Geburtstag. Trotzdem habe ich mir für den November drei Bücher vorgenommen:
Carol von Patricia Highsmith
Virago, 1952. E-Book, 293 Seiten, Englisch
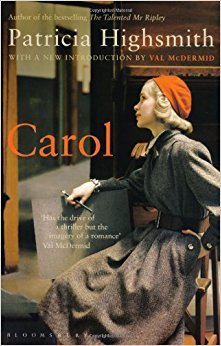
„Alte“ Bücher sind nicht mein Ding. Viel lieber lese ich zeitgenössische Literatur, doch für Carol mache ich eine Ausnahme. Einerseits, weil das Buch auf der TBR-Liste des Banging Book Clubs steht, andererseits, weil es um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen geht.
Der Roman spielt im Jahr 1950 in New York, wo sich zwei Frauen ineinander verlieben, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die junge Therese hat einen schlecht bezahlten Job und einen Freund, den sie nicht liebt, während die ältere, reiche Carol gerade in einem Scheidungsverfahren steckt.
Ich bin besonders gespannt darauf, wie Highsmith mit dem Thema Homosexualität umgeht. In der modernen LGBTQ-Literatur bin ich sehr bewandert, jedoch handelt es sich dabei meist um Coming-of-Age-Geschichten. Carol handelt von Erwachsenen – und für einmal ist es kein YA-Buch.
Carol wurde 2015 mit Cate Blanchett als Carol verfilmt. Meine Hoffnung ist, dass der Film wie auch das Buch die breite Bevölkerung ansprechen und nicht als „Genre-Literatur“ abgetan werden.
Das Leben ist gut von Alex Capus
Hanser, 2016. Hardcover, 240 Seiten, Deutsch
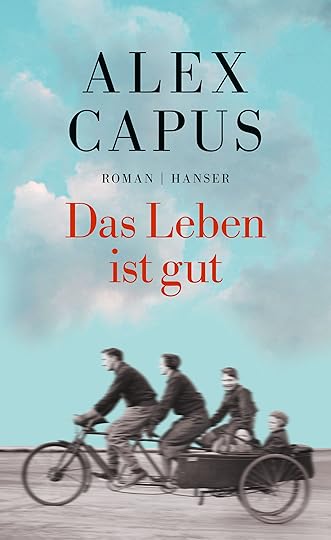
„Ich bin mir nicht sicher, ob es dir gefällt“ – mit dieser Aussage hat mein Freund mein Interesse für dieses Buch geweckt, er selbst war
nämlich begeistert davon. Zu meiner Schande muss ich zugeben, dass ich noch kein einziges Buch vom Schweizer Autor Alex Capus gelesen habe, darum steht Das Leben ist gut jetzt auf meiner TBR-Liste.
Zum ersten Mal in ihrer 25-jährigen Ehe sind Max und Tina für einige Zeit voneinander getrennt. Genau wie die Namen der beiden ist auch ihr alltägliches Leben gewöhnlich, ja vielleicht sogar langweilig. Doch die zeitweilige Trennung macht ihnen bewusst, dass sie es lieben, so wie es ist.
Ich habe einen Verdacht, warum mein Freund meinte, ich würde Das Leben ist gut nicht mögen: Manchmal habe ich Mühe mit Büchern, in denen „nichts“ passiert. Allzu viel Alltag verleidet mir irgendwann. Doch Capus Roman wurde zumindest in der Schweiz hoch gelobt und verkauft sich sehr gut, deshalb hoffe ich jetzt einfach mal, dass es auch etwas für meinen Geschmack ist …
None of the Above von I. W. Gregorio
Balzer & Bray, 2015. E-Book, 328 Seiten, Englisch
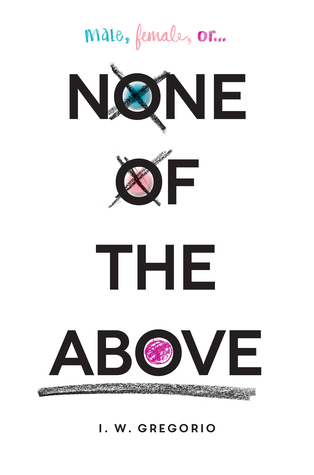 Um ehrlich zu sein, weiss ich über dieses Buch noch so gut wie nichts. Darüber gestolpert bin ich in einer Sammlung von aktuellen LGBTQ-Büchern irgendwo im World Wide Web. Ich fand den Titel besonders ansprechend, da er auf eine Gender-Problematik hinweist – und genau darum geht’s in None of the Above.
Um ehrlich zu sein, weiss ich über dieses Buch noch so gut wie nichts. Darüber gestolpert bin ich in einer Sammlung von aktuellen LGBTQ-Büchern irgendwo im World Wide Web. Ich fand den Titel besonders ansprechend, da er auf eine Gender-Problematik hinweist – und genau darum geht’s in None of the Above.
Die Protagonistin ist intersexuell, das heisst, dass sie sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale hat und sie nicht eindeutig einem Geschlecht zugeteilt werden kann. In None of the Above erzählt Gregorio die Geschichte eines Teenage-Mädchens, das nicht wirklich ein Mädchen, aber auch nicht wirklich ein Junge ist.
Von einem Buch wie diesem erwarte ich, dass Identität, genauer die Geschlechtsidentität, ein grosses Thema ist. Unsere Gesellschaft weiss noch nicht, wie sie mit Menschen umgehen soll, die anders sind, die man nicht einfach in die eine oder andere Schublade stecken kann. Ich hoffe, dass uns I. W. Gregorio ermutigt, solchen Menschen gegenüber verständnisvoll, offen und hilfsbereit zu sein.
Und was liest du?
Im November wird zwar viel los sein, aber jetzt habe ich erstmal eine Woche Ferien. So kann ich für den stressigen zweiten Teil des Monats etwas Lesen vorholen. Ich freue mich auf den Lesemonat November! Und was liest du gerade?
Newsletter
Der Newsletter informiert dich über die neuesten Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag To Be Read: November 2017 erschien zuerst auf The Zurich Review.
October 18, 2017
Rezension: The Virgin Suicides
On the morning the last Lisbon daughter took her turn at suicide – it was Mary this time, and sleeping pills, like Therese – the two paramedics arrived at the house knowing exactly where the knife drawer was, and the gas oven, and the beam in the basement from which it was possible to tie a rope. (1)
So lautet der erste Satz von Jeffrey Eugenides‘ erstem Roman, The Virgin Suicides. Wie diese Worte bereits verraten, lebt der Roman vor allem von einem: von Foreshadowing. Auf der allerersten Seite erfahren wir, dass sich alle Töchter der Familie Lisbon umbringen werden. Ganz unwillkürlich werden sich die meisten Leser*innen dabei ertappen, wie sie während des ganzen Buches auf das Unvermeidbare warten.
Der Amerikaner Jeffrey Eugenides schrieb The Virgin Suicides im Jahr 1993. Seither hat er zwei weitere Romane geschrieben, The Marriage Plot und Middlesex. Sein erster Roman gilt als moderner Klassiker und wurde in 35 Sprachen übersetzt.
Zum Inhalt
In The Virgin Suicides geht es nicht darum, dass sich die Mädchen umbringen, sondern weshalb. Und genau das versuchen die Erzähler, eine nicht identifizierte Gruppe von jungen Männern aus der Nachbarschaft, herauszufinden. Die Erzählung findet einige Jahre nach den Suiziden statt. Die Männern haben das Leben und Leiden der Lisbon-Schwestern akribisch aufgezeichnet. Sie haben Beweisstücke gesammelt und durchnummeriert, Interviews geführt und selbst jahrelang beobachtet – und so versuchen sie nun, das Rätsel um die Suizide zu lösen.
Auch wenn der Titel das Gegenteil vermuten lässt, sind die wahren Protagonisten die Männer, nicht die Lisbon-Mädchen. Die Geschichte wird aus ihrer Perspektive erzählt. Die jungen Männer aus der Nachbarschaft bewundern die Mädchen aus der Ferne; sie sind ihre Objekte der Begierde. Doch die Jungs können nicht an die Mädchen herankommen, weil deren Eltern sie streng überwachen und ihnen keinerlei Freiheiten lassen.
Nach dem Tod der ersten Schwester zieht sich die Familie Lisbon noch weiter zurück, sogar so weit, dass sie die Mädchen aus der Schule nehmen. Von da an werden sie kaum mehr draussen gesichtet, und die Männer versuchen, auf irgendeine Weise Kontakt mit ihnen aufzunehmen. In der Zwischenzeit halten sie sich an jeder noch so kleinen Erinnerung fest, um das Wesen der Mädchen – die sie meist als ein Kollektiv sehen und nicht als Individuuen – zu ergründen, bis sie schliesslich alle fort sind.
Aufbau und Stil
Wie bereits erwähnt, ist Foreshadowing ein wesentliches Merkmal von The Virgin Suicides. Jeffrey Eugenides schafft es, einem den Ausgang der Geschichte von Anfang an aufzutischen und dennoch so zu schreiben, dass man unbedingt weiterlesen will. Man will wissen, wie und warum es zu den schrecklichen Suiziden kam. Dabei wird man in die Perspektive der jungen Männer gezogen, auch wenn man das vielleicht gar nicht will.
Am Ende musste ich mir eingestehen, dass ich – genau wie die Jungs – die Lisbon-Mädchen überhaupt nicht kannte. Cecilia, die erste der Schwestern, die sich umbringt, sagt nach ihrem ersten, fehlgeschlagenen Suizidversuch zum Arzt:
Obviously Doctor, you’ve never been a thirteen-year-old girl. (2)
Und genau das ist der Punkt: Die jungen Männer sehen die Mädchen als arme, unglückliche Wesen, ja Objekte, ohne zu wissen, was wirklich in ihnen vorgeht. Mit ihren „Ermittlungen“ hoffen sie auf einen Hinweis darauf, dass die Lisbon-Mädchen sie genauso geliebt hatten wie umgekehrt. Doch ihre Hoffnungen werden enttäuscht …
Man könnte meinen, dass ein Buch mit einem solchen Titel traurig und melancholisch sei. Aber Jeffrey Eugenides bringt mit seinem ausgezeichneten Schreibstil auch eine Prise makaberen Humor hinein, zum Beispiel mit dem Streik der Friedhofsarbeiter*innen, die dummerweise genau in dem Jahr streiken, indem die Lisbon-Mädchen sich alle umbringen:
Mr. and Mrs. Lisbon, only in their forties, with a crop of young daughters, had given little thought to the strike, until those same daughters began killing themselves. (3)
Und was soll man davon halten?
The Virgin Suicides erzählt eine wahrlich zwiespältige Geschichte, die vielleicht ein bisschen Geschmackssache ist. Mir persönlich hat Jeffrey Eugenides‘ Schreibstil sehr gut gefallen. Er weiss, wie er seine Leser*innen dazu bringen kann, immer weiter und weiter zu lesen, obwohl in grossen Teilen des Buches eigentlich überhaupt nichts passiert und man den Ausgang schon kennt.
Die Sichtweise der jungen Männer ist besonders interessant. Gemeinsam haben sie sich in die Sache hineingesteigert und vergöttern sie diese fünf Mädchen, die sie eigentlich gar nicht kennen. Ich sehe darin eine Art Parodie, denn mit seiner humorvollen und sarkastischen Schreibweise macht sich der Autor genau darüber lustig: über die Hoffnungslosigkeit des Versuches, die Mädchen aus der Ferne zu verstehen und zu kennen.
Übersetzungen
Die Zitate wurden für diesen Artikel von mir selbst übersetzt, es handelt sich daher nicht um die offizielle Übersetzung des Romans.
An dem Morgen, an dem sich die letzte der Lisbon-Töchter umbrachte, – diesmal war es Mary, mit Schlaftabletten, genau wie Therese – kamen die Sanitäter ins Hause und wussten genau, was wo war: die Messerschublade, der Gasofen und der Balken im Keller, an dem man ein Seil befestigten konnte.
Wie es aussieht, Doktor, waren Sie noch nie ein 13-jähriges Mädchen.
Mr. und Mrs. Lisbon, in ihren Vierzigern und mit einem ganzen Haufen junger Töchter, hatte sich nie gross für den Streik interessiert, bis eben diese Töchter begannen, sich selbst umzubringen.

The Virgin Suicides kaufen
Die deutsche Ausgabe von The Virgin Suicides ist 2005 unter dem Titel Die Selbstmord-Schwestern im Rowohlt Verlag erschienen.
Erscheinungsdatum: 01.07.2005, 250 Seiten
Bei Orell Füssli kaufen: Fr. 12.90
Du möchtest mehr von mir hören?
Dann abonnieren den TZR-Newsletter! Er informiert dich über alle neuen Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag Rezension: The Virgin Suicides erschien zuerst auf The Zurich Review.
October 10, 2017
Ich bin rassistisch, und du auch
„A young brown babe from the Bronx“, das ist Juliet Palante. Die Protagonistin von Gabby Riveras Young-Adult-Roman Juliet Takes a Breath gehört zu gleich drei benachteiligten Gruppen in unserer Gesellschaft: Sie ist dunkelhäutig („braun“, wie sie es selbst beschreibt), eine Frau und erst noch lesbisch.
„Ach“, denkst du dir jetzt vielleicht, „die Frauen sind doch mittlerweile fast gleichberechtigt …“ Ich gebe zu: Heute sind wir der Gleichstellung vielleicht so nah wie noch nie, aber das betrifft weisse Frauen. Für schwarze Frauen ist es nochmal eine ganz andere Geschichte.
„Okay, aber dunkelhäutige Menschen sind den hellhäutigen in der Gesellschaft gleichgestellt“, magst du jetzt sagen. Nach acht Jahren Obama könnte man das vielleicht meinen, aber Obama ist ein Mann, und heterosexuell. Sicher merkst du langsam, worauf ich hinauswill …
***Terminologische Anmerkung***
In diesem Essay verwende ich für Menschen mit dunkler Hautfarbe bewusst die Begriffe „schwarz“ und „braun“, und zwar um zu betonen, dass die weisse Vorherrschaft in unserer Gesellschaft nach wie vor eine Tatsache ist. Andere Begriffe wie „Afroamerikaner/-europäer“ verschleiern meiner Meinung nach diese traurige Wahrheit.
One Size Fits All – oder eben nicht
Juliet Palante verbringt ihren Sommer als Praktikantin bei Harlowe Brisbane, einer feministischen Autorin. Juliet hat ihr Buch Raging Flower gelesen und betrachtet es zunächst als eine Art Bibel des Feminismus. Sie ist fasziniert von Harlowe, der Vorzeigefeministin, und ihren Ansichten.
Auf den ersten Blick haben Juliet und Harlowe einiges gemeinsam. Sie sind beide Frauen und beide lieben Frauen. Doch ein Unterschied ist nicht zu übersehen: Harlowe ist weiss. Und während Juliet durch Harlowe erkennt, dass sie ihre eigene Stimme erheben muss, habe ich durch sie erkannt, dass ich rassistisch bin – genau wie Harlowe selbst.
Harlowe Brisbane sei sich den Privilegien bewusst, die sie durch ihre Weissheit hat, sagt sie. Sie sei nicht rassistisch, sagt sie. Und genau mit diesen Aussagen unterstützt sie die weisse Vorherrschaft, die sie eigentlich bekämpfen will. Jennifer Petzen (2) beschreibt das Problem so: „Die Vorherrschaft einer Rasse wird genau von den Leuten zu wenig angegriffen, die behaupten, sich für ihre Zerschlagung einzusetzen.“
Aber schlussendlich ist Harlowe nicht das Problem. Das Problem ist der kollektive, institutionalisierte Rassismus unserer Gesellschaft. Um ihn zu bekämpfen, brauchen schwarze, lesbische Frauen Repräsentation. Wir brauchen mehr Juliet Palantes.
Harlowes Statements bewirken das Gegenteil
Harlowe Brisbane unterstützt die weisse Vorherrschaft, indem sie immer und immer wieder betont, genau dies nicht zu tun. Harlowe hat eine schwarze Partnerin, schwarze Freunde und eine braune Praktikantin. Also kann sie doch gar nicht rassistisch sein, oder? Doch, ist sie. Harlowe Brisbanes Rassismus wird sichtbar, als sie bei einer öffentlichen Lesung Juliet als Beweis benutzt, dass ihr Buch auch Frauen anspricht, die nicht weiss sind:
Ich kenne jemanden, der hier und jetzt mit uns in diesem Raum ist. Sie ist der lebende Beweis: Sie ist im Ghetto aufgewachsen, inmitten von Schiessereien und Drogensüchtigen; sie ist eine lesbische Latina, die ihr Leben lang gekämpft hat, um aus der Bronx hinauszukommen und eine Ausbildung zu erhalten. Sie ist in Armut aufgewachsen, ohne Privilegien, und – vor allem nach ihrem Coming-Out – ohne Unterstützung ihrer Familie. Diese Person ist heute hier: Es ist Juliet Milagros Palante. (1)
Mit dieser Aussage über Juliet beweist Harlowe gar nichts – ausser ihrem eigenen Rassismus. Sie wirft alle schwarzen und braunen Menschen in einen Topf, macht stereotypische Annahmen über Juliets Kindheit und reimt sich Dinge zusammen, die Juliet ihr nie erzählt hat. Und als Juliet sie einige Zeit später darauf anspricht, macht es Harlowe nur noch schlimmer:
Juliet, ich bin ein verdammtes, rassistisches Arschloch und jeder weisse Mensch in diesem Land, der dir etwas anderes sagt, ist ein Lügner. (1)
Hiermit gibt uns Harlowe Brisbane ein perfektes Beispiel einer „kritischen Positionierung“, wie Sarah Ahmed (3) es nennt: Harlowe macht deutlich, dass sie sich für ihren Rassismus schämt. Indem sie dies tut, „beweist“ sie, dass sie nicht rassistisch ist. „Aber“, so Ahmed, „die weisse Person, die sich für ihre Weissheit [oder ihren Rassismus] schämt, ist eine Person, die stolz ist auf ihre Scham.“
Kurz gesagt: Wenn wir zugeben, dass wir schlecht sind, dann zeigen wir, dass wir gut sind. Doch das allein reicht nicht aus. Um wirklich einen Beitrag zur Zerschlagung der weissen Vorherrschaft zu leisten, müssen solchen Worten Taten folgen. Weisse Menschen wie Harlowe Brisbane müssen gegen diejenigen Machtstrukturen kämpfen, denen sie ihre eigenen Privilegien zu verdanken haben.
Rassismus ist ein Problem aller, nicht der*des Einzelnen
Auch wenn jede*r einzelne selbst dafür verantwortlich ist, sich nicht nur gegen Rassismus zu positionieren, sondern aktiv mitzuhelfen, die weisse Vorherrschaft zu zerschlagen, ist das wahre Problem nicht der Rassismus der*des Einzelnen, sondern der kollektive, institutionalisierte Rassismus in unserer Gesellschaft. „Die Ansicht, dass Rassismus ein strukturelles Problem in der Gesellschaft ist, kritisiert die Meinung, dass Rassismus psychologisch ist, oder dass Rassist*innen einfach einzelne, schlechte Menschen sind“, schreibt Ahmed (3) dazu.
Rassismus liegt in der Macht des Kollektivs und wir Weissen machen unsere Weissheit gerne unsichtbar. Indem wir so tun, als wäre sie völlig irrelevant, versuchen wir zu zeigen, dass wir nicht rassistisch sind. Nur, wie Sarah Ahmed treffend sagt (3), können nur diejenigen ihre Weissheit übersehen, die deren Privilegien selbst geniessen.
Insofern ist es wichtig, dass Weisse ihre Privilegien erkennen und sich eingestehen, dass sie privilegiert sind. Denn so zu tun, als wäre die Hautfarbe nur ein optisches Detail, das keinerlei Einfluss auf unsere Chancen und Möglichkeiten im Leben hat, verstärkt den kollektiven Rassismus nur weiter. Denn damit verneinen wir, dass Weisse nach wie vor enorm privilegiert sind.
Und wie weiter?
Nach all den Wenn und Abers fragst du dich vielleicht, wie es nun weitergehen soll. Was müssten Harlowe Brisbane, du oder ich anders machen, um unsere schwarzen Schwestern im Kampf gegen Rassismus und die weisse Vorherrschaft wirklich zu unterstützen?
Jennifer Petzen (2) hat eine Antwort: „Queere Politik, die sich die soziale Gerechtigkeit zum Ziel gemacht hat, muss Rassismus mit politischen Taten bekämpfen, statt sich den Anti-Rassismus nur auf die Fahne zu schreiben.“
Der Rassismus ist in unserer Gesellschaft so tief verankert, dass er teilweise, zumindest von weissen Menschen, überhaupt nicht als solcher wahrgenommen wird. Es ist deshalb klar, dass auch eine klare Antirassistin wie Harlowe Brisbane hin und wieder in den Rassismus verfällt.
Es bringt aber nichts, sich über solche „Rückfälle“ Vorwürfe zu machen. Stattdessen sollten wir uns alle darauf konzentrieren, gute Unterstützer*innen unserer dunkelhäutigen Mitmenschen zu werden. Wer hilft mit?
Nachweise:
Bild:
Francisco Daum. 2014. Lizenz: Creative Commons 2.0. <https://www.flickr.com/photos/franciscodaum/15288589356/>.
Literatur (eigene Übersetzungen):
Rivera, Gabby. 2016. Juliet Takes a Breath. Riverdale Avenue Books, Riverdale.
Petzen, Jennifer. 2012. „Queer Trouble: Centring Race in Queer and Feminist Politics“. In: Journal of Intercultural Studies 33.3, 289-302. <http://dx.doi.org/10.1080/07256868.2012.673472>.
Ahmed, Sarah. 2004. „The Non-Performativity of Anti-Racism. Presented at CentreLGS Colloquium Text and Terrain: Legal Studies in Gender and Sexuality, University of Kent. <https://www.kent.ac.uk/clgs/documents/pdfs/Ahmed_sarah_clgscolloq25-09-04.pdf>.
Weekly Newsletter
Der Newsletter informiert dich über die neuesten Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag Ich bin rassistisch, und du auch erschien zuerst auf The Zurich Review.
October 9, 2017
Selbst-Interview mit Karin Taglang
Du möchtest wissen, wer hinter The Zurich Review steckt? Ich habe die Bloggerin hinter dem Literatur-Magazin interviewt. Aber Moment, das bin ja ich!
Karin, willst du dich wirklich selbst interviewen? Ist das nicht ein bisschen seltsam?
Vielleicht schon, aber es ist immerhin besser als drei Seiten langweilige Fakten über mich. So können die Leser*innen ein paar Dinge über mich erfahren, die sie vielleicht nicht erwarten. Zum Beispiel, dass ich gerne Selbstgespräche führe. Wer hätte das gedacht?
Na gut, wenn du unbedingt willst. Warum also hast du The Zurich Review gegründet?
Das war eine sehr spontane Idee. Aber lass mich vorne anfangen: Ich habe Englische Sprach- und Literaturwissenschaften an der Uni Zürich studiert und während dem Studium immer viel lieber Linguistik gemacht. Die Literaturwissenschaft war mir irgendwie zu weit hergeholt, zu trocken. Doch nach dem Studium hat es mich plötzlich gepackt. Ich habe angefangen, Bücher nicht mehr einfach nur zu lesen, sondern mir dabei ausführliche Gedanken zu machen. So fand ich einen Weg, mich auf die Aspekte zu konzentrieren, die mich am meisten faszinieren – zum Beispiel Charaktere, die nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen …
Wie zum Beispiel?
Nora Webster, aus dem gleichnamigen Roman von Colm Tóibín. Die verwitwete Nora mag auf den ersten Blick ganz normal wirken, doch ganz leise und unauffällig widersetzt sie sich den Erwartungen der Gesellschaft und kämpft um ihre Selbstbestimmung.
Jetzt habe ich ein paar Fragen aus dem „Ultimate Book Tag“ für dich. Bist du bereit?
Hä, was ist das?
Vergiss es. Beantworte einfach die Fragen.
Okay …
Harry Potter oder Twilight? Begründe deine Antwort.
Harry Potter! Weil J. K. Rowling schreiben kann und weil ich ein bisschen in Hermine verliebt bin.
Riechst du an deinen Büchern?
Ja klar, du etwa nicht?
Welches ist das dickste Buch in deinem Regal?
The Complete Works of William Shakespeare, nehme ich an. Aber das zählt nicht wirklich, das musste ich nämlich für’s Studium kaufen. Ich mag zwar Shakespeare, aber einen solchen Wälzer hätte ich trotzdem nicht freiwillig gekauft.
Was ist dein Lieblingswort?
Das kommt auf die Sprache an: Auf Englisch sicher „transmogrification“, Schweizerdeutsch eher „Chrüsimüsi“ und auf Deutsch fällt mir nichts ein.
Vampire oder Feen? Und weshalb?
Feen, weil ich Irish Dance mache und mein aktueller Modern Set Dance „King of the Fairies“ heisst. Den möchte ich lieber nicht beleidigen …
Zum Schluss noch etwas für die Leser*innen, die sich mehr für The Zurich Review selbst interessieren als für dich. Beschreibe den Inhalt und das Ziel von The Zurich Review in einem Satz.
The Zurich Review ist ein Literatur-Blog im Magazin-Stil mit Fokus auf zeitgenössische Literatur, die denen eine Stimme verleiht, die sonst überhört werden, weil sie sich am Rande der Gesellschaft befinden, nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen, sich für andere einsetzen oder sonst auf irgendeine Weise inspirierend sind und die Welt zu einem besseren Ort machen.
Jetzt fällt mir doch noch ein deutsches Lieblingswort ein: „Nebensatz“.
Danke für das Interview!
Du möchtest mehr von mir hören?
Dann abonnieren den TZR-Newsletter! Er informiert dich über alle neuen Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag Selbst-Interview mit Karin Taglang erschien zuerst auf The Zurich Review.
July 30, 2017
Rezension: How to Build a Girl
In How to Build a Girl geht es um zwei Dinge: Sex und gesellschaftliche Schichten. Das sagt die Autorin Caitlin Moran in einem Interview für BBCNewsnight selbst über ihr Werk (siehe Video). Die Geschichte der jungen Johanna Morrigan aus der britischen Industriestadt Wolverhampton ist völlig überzeichnet, aber einfach irgendwie *geil*.
Moran kennt keine Tabus; sie schreibt, was sie schreiben will, und genauso ist auch ihre Protagonistin: Johanna tut, was sie tun will und wird zu der Person, die sie werden will, und das ist Dolly Wilde.
Denn sie, Johanna Morrigan, ist – wie sie selbst sagt – fett, arm und „nicht schön“. Also entscheidet sie sich mit 14 Jahren, Johanna Morrigan loszuwerden und stattdessen Dolly Wilde zu erschaffen.
I am a very pale, round-faced girl with a monobrow, and eyes that are too small, and lank hair the color of dead mice, and I am not beautiful at all. (1)
Wer bin ich – und wer will ich sein?
An der Oberfläche ist How to Build a Girl die Geschichte eines einsamen, uncoolen Teenage-Mädchens, das sich selbst neu erfindet, auf der Suche nach der Person, die sie sein will. Johanna glaubt, diese Person in Dolly Wilde gefunden zu haben. Sie geht nach London, um Musik-Journalistin zu werden, und erlebt zuerst einmal einen heftigen Kulturschock.
Ihre Kolleg*innen bei ihrem Arbeitgeber „Disc & Music Echo“ führen in den Pausen lautstarke Gespräche über ihren letzten One-Night-Stand, trinken und feiern, was das Zeug hält. Das ist für Johanna anfangs Überforderung pur. Sie weiss nicht, wie sie sich solchen Leuten gegenüber verhalten soll. Also beobachtet sie fleissig und setzt jeden noch so kleinen Hinweis sofort in die Tat um.
I have never been in a building with people who go to restaurants, and have sex. I have never been to a place, or done a thing. It is intoxicating. Things get done here. (2)
Als Dolly ist Johannas primäres Ziel, endlich Sex zu haben. Ihren ersten Kuss hat sie mit Rich, der ihr sagt, sie sei „Trouble“ (Ärger/Stress). Das macht sich Johanna fortan zum Motto. Sie will Ärger stiften, will zu Reden geben. Sie setzt ihre Mission, möglichst bald möglichst viel Sex zu haben, fort und wird, wie sie es selbst nennt, zum „Lady Sex Adventurer“. Von da an ist Johanna aka Dolly nicht mehr zu halten …
Sie schläft mit jedem, der ihr gerade über den Weg lauft, und das ist einer der vielen Tabubrüche, die Caitlin Moran in How to Build a Girl einbaut. Normalerweise gelten Frauen, die viel Sex haben, als „Schlampen“, bei jungen Männern jedoch gilt es als cool. Johannas Sex-Geschichten finden ihren Höhepunkt bei „Big Cock Al“.
In dieser Szene kommt Morans ausgesprochener Sinn für Humor zur Geltung: Der Penis von Al ist so gross, dass Johanna sich davor fürchtet. Sie glaubt, er würde sie erdrücken, wenn sie ihn in sich hineinlassen würde. Natürlich passiert es trotzdem, und dabei weckt Moran eine unvergleichbar lustige, visuelle Vorstellung in ihren Leser*innen, indem sie Johanna einige Tipps für die „Handhabung“ grosser Penisse geben lässt:
In doggy, you can subtly but essentially keep crawling away from the penis – making it impossible to get more than the first five inches inside. During our ten-minute session, I manage to make a whole circuit of the bed on all fours as Al ardently pursues me, kneeling. (3)
„Roh und ehrlich“
Diese Szene zeigt, nebst Morans Humor, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt: Sie schämt sich nicht, Johanna solche sexuell expliziten Beschreibungen in den Mund zu legen, und dafür liebe ich How to Build a Girl. Das Buch ist so unglaublich roh und ehrlich. Im Vergleich zu klassischen Coming-of-Age-Geschichten sind Johannas Erfahrungen nicht romantisch, und auch nicht besonders schön, sondern dreckig, lustig, unschön und schmerzhaft – ehrlich, eben.
Am Ende überdenkt Johanna das Mädchen, das sie erschaffen hat, und erstellt eine Liste, welche von Dollys Eigenschaften sie beibehalten möchte. Auf dieser Basis baut sie weiter. Menschen werden zu diesem, dann zu jenem. Das ist ein endloser Prozess.
Sich „ein Mädchen zu bauen“ – diese Mission kann und soll niemals enden. Johanna ist gleichzeitig bedauerns- und bewundernswert. Sie macht so unglaublich viele Fehler, aber sie folgt ihren Wünschen und gibt die Suche nach dem, was sie sein will, niemals auf.
Übersetzungen
Die Zitate wurden für diesen Artikel von Karin Taglang übersetzt, es handelt sich daher nicht um die offizielle Übersetzung des Romans.
Ich bin ein sehr blasses Mädchen mit rundem Gesicht, einer Monobraue und zu kleinen Augen. Mein Haar ist strähnig und hat die gleiche Farbe wie tote Mäuse, und ich bin überhaupt nicht schön.
Ich war noch nie im selben Gebäude mit Leuten, die Restaurants besuchen und Sex haben. Ich war noch nirgendwo und habe noch nichts gemacht. Es ist faszinierend. Hier passieren Dinge!
Beim Doggy-Style kannst du dem Penis ganz unauffällig davonkriechen – so vermeidest du, dass mehr als die ersten paar Zentimeter in dich eindringen. Während den zehn Minuten mit Al habe ich praktisch einen ganzen Kreis auf dem Bett gemacht, und Al verfolgte mich, kriechend, wie ein Wilder.
How to Build a Girl kaufen

How to Build a Girl ist 2014 bei Harper Collins erschienen (nur auf Englisch).
Erscheinungsdatum: 23.9.2014, 352 Seiten
Bei Orell Füssli kaufen: Fr. 30.90
Newsletter
Unser Newsletter informiert dich über alle neuen Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag Rezension: How to Build a Girl erschien zuerst auf The Zurich Review.
How to Build a Girl
In How to Build a Girl geht es um zwei Dinge: Sex und gesellschaftliche Schichten. Das sagt die Autorin Caitlin Moran in einem Interview für BBCNewsnight selbst über ihr Werk (siehe Video). Die Geschichte der jungen Johanna Morrigan aus der britischen Industriestadt Wolverhampton ist völlig überzeichnet, aber einfach irgendwie *geil*.
Moran kennt keine Tabus; sie schreibt, was sie schreiben will, und genauso ist auch ihre Protagonistin: Johanna tut, was sie tun will und wird zu der Person, die sie werden will, und das ist Dolly Wilde.
Denn sie, Johanna Morrigan, ist – wie sie selbst sagt – fett, arm und „nicht schön“. Also entscheidet sie sich mit 14 Jahren, Johanna Morrigan loszuwerden und stattdessen Dolly Wilde zu erschaffen.
I am a very pale, round-faced girl with a monobrow, and eyes that are too small, and lank hair the color of dead mice, and I am not beautiful at all. (1)
Wer bin ich – und wer will ich sein?
An der Oberfläche ist How to Build a Girl die Geschichte eines einsamen, uncoolen Teenage-Mädchens, das sich selbst neu erfindet, auf der Suche nach der Person, die sie sein will. Johanna glaubt, diese Person in Dolly Wilde gefunden zu haben. Sie geht nach London, um Musik-Journalistin zu werden, und erlebt zuerst einmal einen heftigen Kulturschock.
Ihre Kolleg*innen bei ihrem Arbeitgeber „Disc & Music Echo“ führen in den Pausen lautstarke Gespräche über ihren letzten One-Night-Stand, trinken und feiern, was das Zeug hält. Das ist für Johanna anfangs Überforderung pur. Sie weiss nicht, wie sie sich solchen Leuten gegenüber verhalten soll. Also beobachtet sie fleissig und setzt jeden noch so kleinen Hinweis sofort in die Tat um.
I have never been in a building with people who go to restaurants, and have sex. I have never been to a place, or done a thing. It is intoxicating. Things get done here. (2)
Als Dolly ist Johannas primäres Ziel, endlich Sex zu haben. Ihren ersten Kuss hat sie mit Rich, der ihr sagt, sie sei „Trouble“ (Ärger/Stress). Das macht sich Johanna fortan zum Motto. Sie will Ärger stiften, will zu Reden geben. Sie setzt ihre Mission, möglichst bald möglichst viel Sex zu haben, fort und wird, wie sie es selbst nennt, zum „Lady Sex Adventurer“. Von da an ist Johanna aka Dolly nicht mehr zu halten …
Sie schläft mit jedem, der ihr gerade über den Weg lauft, und das ist einer der vielen Tabubrüche, die Caitlin Moran in How to Build a Girl einbaut. Normalerweise gelten Frauen, die viel Sex haben, als „Schlampen“, bei jungen Männern jedoch gilt es als cool. Johannas Sex-Geschichten finden ihren Höhepunkt bei „Big Cock Al“.
In dieser Szene kommt Morans ausgesprochener Sinn für Humor zur Geltung: Der Penis von Al ist so gross, dass Johanna sich davor fürchtet. Sie glaubt, er würde sie erdrücken, wenn sie ihn in sich hineinlassen würde. Natürlich passiert es trotzdem, und dabei weckt Moran eine unvergleichbar lustige, visuelle Vorstellung in ihren Leser*innen, indem sie Johanna einige Tipps für die „Handhabung“ grosser Penisse geben lässt:
In doggy, you can subtly but essentially keep crawling away from the penis – making it impossible to get more than the first five inches inside. During our ten-minute session, I manage to make a whole circuit of the bed on all fours as Al ardently pursues me, kneeling. (3)
„Roh und ehrlich“
Diese Szene zeigt, nebst Morans Humor, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt: Sie schämt sich nicht, Johanna solche sexuell expliziten Beschreibungen in den Mund zu legen, und dafür liebe ich How to Build a Girl. Das Buch ist so unglaublich roh und ehrlich. Im Vergleich zu klassischen Coming-of-Age-Geschichten sind Johannas Erfahrungen nicht romantisch, und auch nicht besonders schön, sondern dreckig, lustig, unschön und schmerzhaft – ehrlich, eben.
Am Ende überdenkt Johanna das Mädchen, das sie erschaffen hat, und erstellt eine Liste, welche von Dollys Eigenschaften sie beibehalten möchte. Auf dieser Basis baut sie weiter. Menschen werden zu diesem, dann zu jenem. Das ist ein endloser Prozess.
Sich „ein Mädchen zu bauen“ – diese Mission kann und soll niemals enden. Johanna ist gleichzeitig bedauerns- und bewundernswert. Sie macht so unglaublich viele Fehler, aber sie folgt ihren Wünschen und gibt die Suche nach dem, was sie sein will, niemals auf.
Übersetzungen
Die Zitate wurden für diesen Artikel von Karin Taglang übersetzt, es handelt sich daher nicht um die offizielle Übersetzung des Romans.
Ich bin ein sehr blasses Mädchen mit rundem Gesicht, einer Monobraue und zu kleinen Augen. Mein Haar ist strähnig und hat die gleiche Farbe wie tote Mäuse, und ich bin überhaupt nicht schön.
Ich war noch nie im selben Gebäude mit Leuten, die Restaurants besuchen und Sex haben. Ich war noch nirgendwo und habe noch nichts gemacht. Es ist faszinierend. Hier passieren Dinge!
Beim Doggy-Style kannst du dem Penis ganz unauffällig davonkriechen – so vermeidest du, dass mehr als die ersten paar Zentimeter in dich eindringen. Während den zehn Minuten mit Al habe ich praktisch einen ganzen Kreis auf dem Bett gemacht, und Al verfolgte mich, kriechend, wie ein Wilder.
How to Build a Girl kaufen

How to Build a Girl ist 2014 bei Harper Collins erschienen (nur auf Englisch).
Erscheinungsdatum: 23.9.2014, 352 Seiten
Bei Orell Füssli kaufen: Fr. 30.90
Newsletter
Unser Newsletter informiert dich über alle neuen Beiträge auf The Zurich Review. Abonniere ihn jetzt, um nie mehr etwas zu verpassen!
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Email *
Der Beitrag How to Build a Girl erschien zuerst auf The Zurich Review.
Karin Taglang's Blog
- Karin Taglang's profile
- 2 followers



