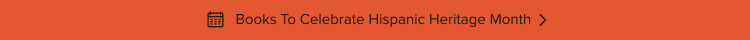Maximilian Buddenbohm's Blog, page 408
September 13, 2012
Auf dem Arbeitsweg
September 12, 2012
Babylon
Während man beim ersten Kind noch in den ersten drei Jahren jedes neugelernte Wort feiern möchte und jeden kleinen Fortschritt in der Grammatik euphorisch im Bekanntenkreis diskutiert, fallen einem zweite Kinder irgendwann dadurch auf, dass sie einfach reden. Und man spricht mit ihnen, gibt Antworten, erklärt etwas, hört auf Fragen und steht dann plötzlich gedankenverloren neben dem Kind und fragt sich leise: „Mit wem rede ich hier eigentlich? Konnte der nicht neulich noch nur Dada sagen?“
Mit anderen Worten, auch mit Sohn II kann man natürlich schon längst diskutieren. Mit Sohn I schon richtig lange, aber erst seit ein paar Wochen bemerke ich immer stärker den verstörenden Umstand, dass beide Kinder tatsächlich unentwegt reden. Dass tun sie wahrscheinlich schon länger, aber manchmal braucht man eben eine Weile, bis es einem auffällt.
Sie reden also beide. Den ganzen Tag. Miteinander, mit mir, und mit allen möglichen Menschen. Mit Steinen, Vögeln, Hunden, Wolken und Vampiren. Mit Gespenstern, mit Monstern, mit Motorrädern, mit Karies und Baktus. Mit den Bananen auf dem Tisch und mit der Puppe, die jeden Tag einen anderen Namen hat, und wehe man nennt den falschen. Heute hieß sie Tristan, aber egal. Wer morgen früh Tristan sagt, wird mit Wutausbrüchen nicht unter 30 Minuten bestraft.
Sie reden also beide und sie reden gleichzeitig. Immer. Und nonstop. Vergleichsweise häufig verlangen sie eine Antwort oder irgendeine andere Reaktion. Wenn Sie keine Kinder haben, werden Sie das vielleicht nicht kennen, aber Sie werden sich in meine Lage leicht einfühlen können, wenn Sie kurz folgende Versuchsanordnung aufbauen möchten: Stellen Sie ein Radio links und eines rechts von sich auf. Verdrehen Sie dann bei beiden gleichzeitig langsam die Sender, so dass Sie im Prinzip nur mehr oder weniger sinnlose Brocken aus beiden Richtungen wahrnehmen können. Versuchen Sie, auf möglichst viele Brocken logisch korrekt zu reagieren. Singen Sie Lieder weiter, kommentieren Sie den Wetterbericht, beantworten Sie Quizfragen, lachen Sie über seltsame Namen, fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Sie haben für jede Reaktion eine Sekunde Zeit. Machen Sie das zehn Minuten und stellen Sie sich dann vor, Sie müssten es zum Beispiel ein ganzes Wochenende tun. Behandeln Sie Eltern fortan mit Respekt und Nachsicht.
Gestern ging ich mit den Söhnen zur Bücherei, ich hatte Sohn II auf der Schulter, er sprach mir von da aus bequem direkt ins Ohr, das er mit einer Hand nach oben bog. Ich hatte Sohn I an der Hand, an der er fortwährend mit seinem ganzen Gewicht zog, um meine ungeteilte Aufmerksamkeit zu gewinnen. Man kann zwei Kindern nicht zugleich zuhören, es ist beim besten Willen nicht menschenmöglich, dem endlosen überkreuzten und heillos verflochtenen Singsang genug Sinn abzugewinnen, um beiden gerecht zu werden. Ich habe aber während dieses Weges das Essen für die nächsten Tage geplant, mit der Herzdame telefoniert, diesen Blogeintrag konzipiert und über eine noch zu schreibende Kolumne nachgedacht. Ich habe mich per SMS verabredet, zwei Touristen den Weg erklärt und auch noch permanent links und rechts irgendwelche Antworten in Richtung eines Kindes gegeben. Das Büro rief zwischendurch wegen einer Softwarepanne an und eine ältere Dame erklärte mir ungefragt, wo meine Kinder bei der Ampel hingucken müssten.
Ich habe mich verändert, dachte ich zwischendurch, mein Hirn hat sich irgendwann angepasst. Ich bin schon längst ein geistiges Zweistromland geworden. Links und rechts strömt es endlos ergiebig an mir vorbei, und in der Mitte ist es fruchtbar, aus mir wird doch noch eine Hochkultur. Im Grunde kann ich überhaupt nur noch schreiben, weil ich langsam verrückt werde, das wird es sein. Ich versuchte, den Gedanken festzuhalten, ich sagte „Nächste Woche“ und „Zwölf“ zu den Kindern, damit sie endlich einmal Ruhe gaben. Beide Antworten waren vollkommen wahllos, manchmal kommt man damit durch, manchmal nicht. Die Kinder sahen mich ratlos an, holten Luft und öffneten die Münder. Ich legte nach und sagte zu dem einen „Der Herbst“ und zu dem anderen „Mit Wurst“, da nickten beide zufrieden und schwiegen lange, also bestimmt zwei Minuten. Manchmal muss man einfach ein wenig Glück haben. „Man redet irgendwas und schon wird alles gut“, um einmal Herman van Veen zu zitieren, ich lasse hier ja bekanntlich keine Peinlichkeit aus.
Ich blieb stehen und tippte „Zweistromland“ als Notiz ins Handy, während mich Sohn II fragte, ob er auf meinem Handy etwas ausmalen könne und Sohn I einfiel, dass er einmal die Herzdame anrufen könne. Dann haben sie sich um das Handy geprügelt, aber die Notiz war gespeichert.
Heute Mittag hatte ich ein berufliches Treffen, es ging um das Schreiben und ich wurde gefragt, wie ich denn bei Mehrfachbelastung mit mehreren Berufen und Kindern überhaupt noch schreiben könne. Ich hoffe, ich habe es ein wenig erklärt.
September 11, 2012
Gespräch an der Bettkante
Sohn I schleppt ein Buch an, ich soll noch schnell eine Geschichte vorlesen. Er blättert darin herum, es ist ein Vorlesebuch mit vielen Geschichten. Dann findet er ein Bild, das ihm gefällt, es zeigt einen großen Stapel Bücher gleich unter der Überschrift der Geschichte.
Sohn I: „Wie heißt diese Geschichte hier?“
Ich: „Die heißt „Der geplagte Schriftsteller.“
Sohn I: „Aha. Und da geht es dann um einen Maximilian, was?“
Apulic
Mich treibt schon seit Monaten eine Vokabelfrage um, die ich bisher weder durch diverse Muttersprachler noch durch wissenschaftliche Kenner von Sprachen lösen konnte. Vielleicht fällt einem Blogleser etwas ein?
Es geht um die Sprache der Kinder. Die Söhne werden beide zu einem nicht unerheblichen Teil der Kindergartenzeit von Erzieherinnen betreut, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind. Polnisch, Portugiesisch, Ungarisch und auch Werweißwoher sind am manchmal deutlichen Akzent zu erkennen. Das wirkt sich natürlich auch auf den Spracherwerb der Kinder aus, und zwar in einer Weise, die von den meisten sicherlich nicht erwartet wird. Sie sprechen nämlich ein deutlich gepflegteres Deutsch, als es für die Altersklasse typisch ist. Sie sagen zum Beispiel nicht „Guck mal da“ – sie sagen „Sieh einmal dort“. Sie sagen nicht „Hammer, issas geil“, sie sagen „Schau, wie schön.“
Diese seltsam spießig anmutende Wortwahl hat mich eine Weile erheblich gewundert, bis ich darauf kam, dass die Edelsprache einfach daran liegt, dass die Erzieherinnen, durchweg sehr um gutes Deutsch bemüht, mit den Kindern schönstes Schulbuchdeutsch sprechen. In gewissen Formulierungen also korrekter, als es eine deutsche Kollegin auf Dauer wäre, und auch etwa beim Vorlesen dem Text Buchstabe für Buchstabe treuer, als es mir jemals einfallen würde.
Natürlich gibt es aber auch Kinder aus aller Herren Länder im Kindergarten, und natürlich streuen die hier und da Vokabeln und Formulierungen in den gemeinsamen Wortschatz ein. Sohn I singt manchmal verblüffend kenntnisreich portugiesische Schlager, Sohn II kann auf Englisch ordinärer sein, als es seine deutsche Vokabeln überhaupt zuließen. Das kann man wohl auch alles so erwarten und ich finde es toll. Die Welt ist bunt und unser kleines Bahnhofsviertel ist sogar ganz besonders bunt, das soll auch ruhig im Kindergarten so stattfinden.
Das Rätsel, das mich nun umtreibt, liegt aber in einer Formulierung, die allen Kindergartenkindern gemein zu sein scheint, und die mir bisher niemand erklären konnte. Wenn etwas verboten ist, und jemand das dennoch macht, dann sagen die Kinder: „Apulic!“ Gesprochen wie Apulidsch, betont auf der zweiten Silbe, der Zischlaut am Ende etwas unklar, mal schärfer, mal weicher, mal hört man ein d, mal ein t vor dem s oder sch, es bleibt unerfindlich. Stehen sie an der Ampel und ein Erwachsener geht bei Rot, ertönt ein scharfes, missbilligendes „Apulic!“ aus mehreren Kindermündern. Klettert ein Kind über den Zaun des Spielplatzes, wird ihm von hinten warnend „Apulic!“ nachgerufen. Über die Bedeutung des Begriffs gibt es kollektive Einigkeit im Kindergarten.
Keine Erzieherin hat eine Idee dazu, keine Polin kennt das Wort, keine Portugiesen scheinen es jemals gehört zu haben. Sämtliche Eltern sind ratlos. Aber für ein ganzes Kinderrudel, das gar nicht einmal so klein ist, scheint es eine ganz gewöhnliche Vokabel zu sein. Zur Herkunft macht allerdings niemand eine sinnige Angabe, und wenn man die Kinder nach der Sprache fragt, dann gibt es dazu sehr viele Meinungen, fast so viele, wie es Nationalitäten im Kindergarten gibt.
Es lässt mir keine Ruhe. Hat jemand eine Idee? Türkisch und Indonesisch wären noch naheliegende Optionen, ebenfalls Rumänisch, Russisch, Spanisch und Persisch. Und bestimmt auch noch Sprachen, auf die ich gar nicht komme.
September 10, 2012
Auf dem Arbeitsweg
September 9, 2012
September
Die große Kindergeburtstagsindianerparty liegt hinter uns und hat fast keine Spuren hinterlassen. Sohn II möchte nicht mehr ohne Cowboykostüm aus dem Haus gehen und Sohn I möchte jetzt gerne ein Pony zu seinem Indianer-Outfit, aber sonst – alles wieder ruhig. Ich gehe davon aus, dass die Herzdame und ich schon in wenigen Wochen fast vollständig erholt sein werden. In etwa rechtzeitig zu Weihnachten also.
In diesem Zusammenhang noch ein Dank für die anonymen Geschenksendungen, das wurde hier alles mit großer Freude aufgenommen. Tatsächlich hat das Publikum dieses Blogs gar nicht unerheblich zu den Geburtstagen beigetragen, ich finde das ganz wunderbar. Und die Jungs finden das natürlich noch viel wunderbarer und sagen jedesmal, ich soll danke sagen, da mit dem Computer, mit dem ich auch sonst mit den Leuten rede. So: Danke.
Und nun, wo der Sommer in wenigen Tagen abdanken und kopflos aus dem Land flüchten wird, wo alle Ausflüge gemacht und alle Urlaubstage verbraten sind, nun wollen wir einmal sehen, ob einem indoor, wie wir trendigen Menschen in den Zentren der Großstädte zu unseren Wohnzimmern sagen, auch noch irgendwelche Themen einfallen.
September 6, 2012
Auf dem Arbeitsweg
September 5, 2012
Die berittenen Buddenbohms
Auf dem Bauernhof in Dagebüll gab es, wie bereits kurz angedeutet, fast keine Tiere, aber es gab doch immerhin einen ziemlich großen Pferdestall nebenan. Dessen Türen einladend offen standen. Verständlich also, dass die Söhne bereits Minuten nach unserer Ankunft auf dem Hof in den Stall verschwanden, wo auch schon ein paar andere Kinder waren. Ein paar davon ritten gerade in einer angrenzenden Halle, die auch nicht gerade bescheiden dimensioniert war, auf Ponys im Kreis herum. Die Söhne sahen die anderen Kinder an, sahen die Pferde an und sahen dann mich an, mit einem dieser Blicke, nach denen vermutlich auch Darth Vader ihnen einen Lolly gekauft hätte. Mindestens. Ich machte also mit der Reitlehrerin, die gerade einer Horde etwa zwölfjähriger Mädchen am praktischen Beispiel erklärte, wie man ausgewachsene Pferde auf einen Anhänger bekommt, einen Termin für den nächsten Tag aus. Die Mädchen machten rosafarbene Kaugummiblasen, die Reitlehrerin rauchte filterlos und selbstgedreht und die Söhne bissen sich vor Aufregung auf die Finger. Das Pferd mümmelte Heu vom Boden des Anhängers. Ich bekam plötzlich Hunger.
Kurz vor dem Beginn der Reitstunde klärten wir die Söhne darüber auf, dass die Reitlehrerin gar nicht für die niedlichen Ponys zuständig war, sondern für die aus Kindersicht ziemlich großen Haflinger. Die Ponys waren in Privatbesitz und nicht verfügbar. Die Söhne sahen mich nach dieser Botschaft nachdenklich und ein wenig skeptisch an und hatten es plötzlich nicht mehr ganz so eilig, in den Stall zu kommen. Langsamer werdende Schritte, erst einmal hier und da ein paar Steinchen aufheben, nachdenken, doch lieber stehenbleiben. Ich erklärte Sohn II, dass Ponys etwas für eher kleine Kinder seien, damit war die Sache für ihn schon erledigt, er wollte sofort auf das große Pferd. Dann erklärte ich Sohn I, dass man auf dem Haflinger viel besser sitzen könne, das sei ja nicht so ein unruhiges Geschüttel wie auf einem nervösen Pony, und damit war er dann auch sehr einverstanden. Die Söhne liefen weiter fröhlich geradeaus, Richtung Stall. Vielleicht hätte ich doch Motivationstrainer werden sollen.
Dann stand Sohn II in der Reithalle vor dem Haflinger, dessen Kopf da irgendwo ganz weit über ihm war. Wenn man die Perspektive auf Erwachsene umrechnet, dann wäre das Pferd etwa so hoch wie ein zweistöckiges Gebäude, das ist schon eine sehr beachtliche Höhe. „Ich heb dich mal rauf“, sagte die Reitlehrerin. „Selber“, sagte Sohn II entschlossen und schüttelte energisch den Kopf. Also wurde ihm ein Schemel geholt, auf den er steigen konnte, und dann musste man ihn nur noch ein ganz wenig anheben, damit er an den Sattel greifen konnte, um sich selbst das letzte Stück hochzuziehen. Setzte sich oben zurecht, das Pferd ging los und das Kind strahlte vom ersten Schritt an, als hätte man in der dämmerigen Reithalle ein Licht angemacht. „Schneller?“ fragte die Reitlehrerin nach einer Weile und „ja“ sagte Sohn II ganz leise aber sicher. Das Pferd trabte an, er klammerte sich hochkonzentriert fest – alles kein Problem. „Jetzt mal hinstellen“, sagte die Reitlehrerin und Sohn II war sofort auf den Knien. Das Pferd hielt augenblicklich an. Sohn II stand und breitete die Arme aus, alles Glück der Welt im Gesicht.
Die Reitlehrerin erklärte uns, dass das Pferd eine Spezialausbildung durchlaufen hatte, es wurde für heilpädagogisches Reiten eingesetzt. Darauf ritten also Menschen mit verschiedenen Behinderungen, etwa Blinde oder auch Rollstuhlfahrer, autistische Kinder und Menschen mit Pferdeangst und so weiter. So ein Pferd hält an, wenn es merkt, dass auf ihm jemand aufsteht, herumturnt, sich komisch benimmt oder krampft.
Sohn II durfte nach seinen Runden über den Po des Pferdes hinunterrutschen, eine Art des Abstiegs die sich durchaus nicht bei jedem Gaul empfiehlt, wenn man nicht plötzlich ungewöhnlich stark beschleunigt werden möchte.
Sohn I, der als nächster an der Reihe war, machte natürlich noch ein paar Kunststücke mehr als Sohn II, legte sich quer und kopfüber über das Pferd, machte Kunstturnfiguren und ritt rückwärts, die Lehrerin erklärte das alles sehr ruhig, angenehm und kindgerecht.
Dann ritten beide Kinder zusammen, Sohn II sitzend, Sohn I hinter ihm stehend, sie sahen aus wie der Nachwuchs einer Artistenfamilie bei der nachmittäglichen Trainingsrunde. Es ist immer wieder beeindruckend, was Kinder alles sofort können, wenn sie nur vollkommen angstfrei an ein Thema herangeführt werden. Eine Woche auf dem Hof und die beiden hätten vermutlich im Zirkus auftreten können.
„Jetzt die Mutter“, sagte die Reitlehrerin, und das war eigentlich nicht so geplant gewesen. Aber die Herzdame gehört zu dieser Mädchengeneration, deren Pferdewunsch als Kind nicht recht bedient wurde, ein nagendes Verlangen nach dem Reitsport ist ihr seit damals immer erhalten geblieben. Sie sagte sofort ja. Stieg auch mit einem Schemel auf das Pferd, wobei Sohn II ihr an Eleganz allerdings einiges voraushatte. Aber Eltern klettern ja auch nicht gerade jeden Tag auf etwas herum, schon gar nicht auf sehr bewegliche Klettergerüsten. Dann ritt die Herzdame ein paar Runden. Im Gegensatz zu den Kindern wurde sie nicht geführt, sondern machte alles ganz alleine. Bzw. das Pferd machte alles alleine, denn einem erkennbaren Muster folgten die Runden eher nicht. Wahlloses Zickzack, sinnlose Schnörkel, lässige Schleifen, das Pferd ging einfach ein wenig gelangweilt spazieren, während die Herzdame oben etwas ratlos an den Zügeln zog. Das war also doch gar nicht so einfach. Aber auch die Herzdame sah sehr glücklich aus, und auch die Herzdame stand nach einer Weile auf dem Pferd, mit ausgebreiteten Armen und vorbildlicher Haltung, wirklich bewundernswert. Wenn auch ihr Gesichtsausdruck nicht ganz zu „Ich bin die Königin der Welt“ passen wollte. Das mag aber auch daran gelegen haben, dass ihr dauernd der Helm über die Augen rutschte. Es ist ohnehin ein Grundproblem des Reitsports, dass die meisten Menschen mit Reiterhelm schlicht etwas doof aussehen, daran müsste man dringend etwas ändern.
„Jetzt der Papa“, sagte die Reitlehrerin.
„Klar“, sagte ich, „kein Problem. Das letzte Mal ist ja erst 34 Jahre her.“ Und schon war ich oben. Na gut, nicht ganz. Schon lag ich quer über dem Pferd und dachte intensiv darüber nach, wie denn das Aufsteigen bloß früher ging, während die Söhne fragten, was Papa da denn machte und die Reitlehrerin und die Herzdame mir ernsthaft versicherten, dass man mir das wirklich gleich ansehen könne, dass ich früher sehr viel geritten sei.
Was soweit aber tatsächlich stimmt. Ich habe zwar nahezu mein ganzes Leben in Büchern erzählt, aber natürlich gab es auch eine Zeit vor Travemünde, die in keinem Buch vorkommt und vermutlich auch nicht vorkommen wird. Und in der hatte die Familie Pferde und ich verbrachte nicht wenig Zeit darauf. Ich bin allerdings mit 12 Jahren zum letzten Mal geritten und habe danach nie wieder ein Pferd aus nennenswerter Nähe gesehen, geschweige denn jemals wieder darauf gesessen. Das Thema war abgehakt. Jetzt war also tatsächlich die Zeit gekommen, ernsthaft über diese berühmte Fahrradfrage nachzudenken. Verlernt man Reiten oder kann man es immer noch – egal, wie viele Jahrzehnte man ausgelassen hat? Beim Radfahren ist das ja angeblich so, dass man einfach wieder losradelt, wobei ich dafür allerdings nie einen Beweis erlebt habe. Es dürfte auch wenig Menschen geben, die sehr, sehr lange nicht Radfahren und dann irgendwann doch wieder. Und wer weiß, vielleicht fallen die in Wahrheit einfach um, und es ist alles nur ein Märchen? Großstadtlegenden, das kennt man ja. Wie ist das wohl beim Reiten? Würden sich die Hände erinnern, wie man Zügel zu greifen hat, die Füße, welche Haltung die richtige ist, die Beine, wie sie den Sitz auszurichten haben, der Rücken, was man im Trab macht, dieses rhythmische Auf und Ab? Ich war sehr gespannt, als ich mich da oben auf dem Haflinger, der auch mir jetzt verblüffend groß vorkam, soweit zurechtgerückt hatte, dass ich nach den Zügeln greifen konnte.
Ich würde die erste Minute auf dem Pferd sofort als eine der interessantesten in diesem Jahr einstufen. Denn es ist tatsächlich so: Der Körper erinnert sich verdammt gut. Die Finger denken „Ach, das wieder, ja, schon klar“. Und die Beine so: „Here we go again“ und der Rücken so: „Hier bei der Arbeit, alles klar, Sir.“ Es ist ein Fest. Es ist ein Fest der Erinnerung, der körperlichen Erinnerung, der seelischen Erinnerung, des kompletten Kindheits-Flashbacks. Der Geruch von Pferd, die Bewegung des Tiers, das Gefühl der Mähne an der Hand, das Licht in der Halle, Abendsonne durch die hohen Fenster, die gedämpften Geräusche der Hufe auf dem schwarzen Sandboden, flirrender Strohstaub in der Luft. Damals, damals, damals! Vollkommen surreal. Mein innerer Zwölfjähriger hatte die Zügel fest in der Hand und nach zwei Runden machte das Pferd tatsächlich, was ich wollte. Lief in die Richtung, in der ich es haben wollte, wechselte die Gangart, hielt an, ritt wieder los – und die Reitlehrerin nickte und lachte und rief „Um Sie müssen wir uns ja gar nicht weiter kümmern.“ Die Herzdame machte Fotos, ich machte mich gerade, obwohl das sicher gar nicht nötig war, dachte ich, denn mein Rücken wusste ja noch, wie ich mich zu halten hatte, ich merkte es ganz deutlich. Ich verzichtete auf Kunststückchen, die habe ich damals ja auch nicht gemacht, ich bin einfach geritten, darum ging es auch in meiner Kindheit. Nur darum, nie um etwas anders. Kein Voltigieren, keine Dressur, keine Albernheiten. Aufs Pferd und los. Ich erinnerte mich plötzlich verblüffend deutlich an einen Moment auf einem Ausritt irgendwann im Frühling Ende der Siebziger Jahre, als mein Pony in rasendem Galopp lief und mir aus dem Unterholz Zweige mit knallgrünem Laub ins Gesicht schlugen und der Waldboden stark nach Mairegen und frischem Kraut duftete und ich wusste, gleich würde der alte Baumstamm kommen, über den man springen musste. Nach vorne beugen, Zügel freier lassen und – Kinderglück.
Ich ritt meine Runden und freute mich sehr, dass es noch ging. Grinste vor mich hin, tätschelte das Pferd. Dann sprang ich schließlich ab und ging gänzlich unerwartet auf dem Boden in die Knie. Denn es ist leider so – die Muskeln erinnern sich zwar, sie können es aber nicht mehr. Sie können es genau genommen überhaupt nicht mehr. Nicht einmal ansatzweise. Die Oberschenkel wie Pudding, wie bebende Götterspeise, da kam gar keine Befehlskette aus dem Hirn mehr an. Butterweich poabwärts, als hätte man da ein paar lokale Anästhesiespritzen gesetzt. Die Reitlehrerin sah auf die Uhr und sagte: „Der Muskelkater beginnt in einer halben Stunde. Viel Spaß, da haben Sie jetzt drei Tage etwas davon. Sehen Sie lieber zu, dass Sie es noch auf ein Sofa schaffen.“ Und sie hat nicht gelogen, das war der Muskelkater meines Lebens, dagegen war alles vorher nur ein Probealarm. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Sessel, wollen die Beine übereinanderschlagen, und es geht einfach nicht. Die Beine machen nicht mit, sind nicht ansprechbar, gehören gar nicht zu Ihnen, lassen Ihnen nur ausrichten, dass sie ihre Ruhe haben wollen. Eine faszinierende Erfahrung.
Ich habe mir dann am nächsten Tag erst die Bilder angesehen, die die Herzdame von mir gemacht hat. Ich werde sie hier aus Pietät meinem inneren Zwölfjährigen gegenüber nicht veröffentlichen. Denn während ich im Erinnerungssturm an einen Heranwachsenden wieder auf meinem Pony von damals gesessen hatte und durch die Wälder am Rande von Lübeck galoppiert bin, hat die Herzdame Bilder von einem älteren Mann gemacht, der in unmöglicher Haltung und mit verstrahltem Gesichtsausdruck auf einem stoischen Haflinger mit müden Augen durch eine halbdunkle Halle trabte, während die Kinder sich am Rand der Reitbahn kaputtlachten. Der Mann da auf den Bildern war meinem Vater verblüffend ähnlich, und mein Vater war damals derjenige in der Familie gewesen, der sich am wenigsten wohl auf einem Pferd gefühlt und nie eine wirklich gute Figur darauf gemacht hat. Ich hatte mich bisher noch nie in einer Pose wahrgenommen, in der ich meinem Vater ähnlich sah. Das war nicht ich, auf diesen Fotos.
Ich habe lange vor den Bildern gesessen. Die Hände, die Hände griffen tatsächlich richtig nach den Zügeln, das konnte ich sehen. Genau so haben sie damals auch zugegriffen, genau so macht man es. Die Hände trugen damals in Lübeck keinen geerbten Siegelring und auch keinen Ehering, sie waren schmaler und kleiner, aber sie machten es so, wie meine Hände es da auf dem Bildschirm machten. Mein innerer Zwölfjähriger und ich saßen gemeinsam vor dem Laptop, sahen uns die Bilder an und staunten übereinander. „Guck mal“, sagte ich etwas entgeistert und zeigte auf den krummen, etwas beleibten Reiter, und ich war mir nicht ganz sicher, wer von uns beiden da gerade gesprochen hatte.
Ich hatte einmal einen Chef, der an seinem fünfzigsten Geburtstag schwere Depressionen bekam. Er sagte mir damals, dass man innen nicht gleichmäßig mitaltern würde, nur außen sei das ein absehbarer Prozess. Er sagte, dass man irgendwann bei bestimmten Situationen ratlos in den Spiegel sehen und es nicht mehr verstehen würde, was man da denn bloß vor sich hätte. Ich habe genickt und es nicht verstanden. Ich war erst dreißig Jahre alt und mein Chef sah auch noch recht knackig aus, fand ich.
Ich verstehe ihn jetzt sehr viel besser.
Auf dem Arbeitsweg
September 4, 2012
Auf dem Arbeitsweg
Maximilian Buddenbohm's Blog
- Maximilian Buddenbohm's profile
- 2 followers